| Volltext anzeigen | |
Träume und Versprecher – Boten des Unbewussten 101 Freud’sche Fehlleistungen Die Freud’sche Fehlleistung ist sprichwörtlich geworden. Man gießt sich den Kaffee statt in die Tasse in die Zuckerdose; man erkundigt sich bei einem Gast aus Versehen, ob er „gut geschnarcht“ habe; man steht dumm mit der Schuhbürste vorm Wäscheschrank und weiß nicht mehr, was man da wollte; man wirft den Brief statt in den Briefkasten in den Müllbehälter; man liest „Scheißstand“, wo „Schießstand“ steht − und in den schlimmeren Fällen möchte man versinken vor Scham; oft aber ist jemand zur Stelle, einen wissend zu trösten: „Na, das war aber eine klassische Freud’sche Fehlleistung.“ Der Alltag ist durchsetzt mit derlei unscheinbaren Versehen, bei denen man tut, was man nicht tun wollte, und sich selber entsprechend fremd und merkwürdig vorkommt. Jede Psychologie, die sie zu erklären unternimmt, kann auf Interesse rechnen. Unter allen Schriften Freuds hat keine soviel Verbreitung gefunden wie seine Aufsatzsammlung Zur Psychopathologie des Alltagslebens (1904), in der er seine Theorie des Versprechens, Verhörens, Verlesens, Vergreifens, Vergessens von Vorsätzen und Namen erstmals darlegte. Das Besondere an dieser Theorie war nicht, dass sie diese winzigen und scheinbar banalen Vorkommnisse des Alltags ernst nahm − das hatten auch schon andere getan. Das Besondere an ihr war, dass sie sie keineswegs für zufällige und beliebige Pannen hielt. Freuds ketzerische Botschaft lautete: Alle diese Patzer hätten ihren guten, nämlich vielmehr meist bösen Sinn. In ihnen verrieten sich gegen unseren Willen die innersten Wünsche, Abneigungen, Befürchtungen, kurz das, was Psychologen heute unsere Motive nennen. Indem man sie analysiere, könne man entdecken, was uns in den Tiefen unterhalb unseres Bewusstseins wirklich bewegt. Dieter E. Zimmer. In: Die Zeit/ZEITmagazin, 01.11.1985 M4 5 10 15 20 25 30 35 1 a) Informiert euch darüber, wie Sigmund Freuds Theorie vom Unbewussten die Kunst des Surrealismus beeinflusst hat (s. auch S. 98-99). ➜ M1 b) Bestimme die Traumelemente des Bildes. ➜ M1 2 Gib die Methode der Traumdeutung nach Sigmund Freud mit eigenen Worten wieder. Stelle die besonderen Schwierigkeiten dar, die bei der Deutung eines Traums entstehen können. ➜ M2 3 Schreibe einen eigenen (nicht allzu persönlichen) Traum auf. Versuche ihn zu deuten, indem du die folgenden Fragen stellst: ➜ M2 Welche „wirklichen“ Erlebnisse kannst du in deinem Traum wiedererkennen? Welche „unbewussten“ Wünsche oder Ängste kommen im Traum zum Vorschein? 4 Sammelt Beispiele von Versprechern und Fehlleistungen und deutet sie im Sinne von Freud (s. auch S. 9899, M2). ➜ M3 5 Erläutert den Text an Beispielen. ➜ M4 6 Versuche die Versprecher zu erklären, indem du das jeweils Unbewusste nennst, das ohne Absicht mitgeteilt wird. ➜ M5 Glossar: Salvador Dalí, Sigmund Freud, Surrealismus Wer verrät was? ❯ Die reizt nicht mit ihren Geizen. ❯ Auflauftraining ❯ Ins Grab beißen ❯ Schließlich kann ich nicht zwei Fliegen auf einmal dienen. ❯ Die sitzt fett im Sattel. ❯ Schweinschwangerschaft ❯ Da ging mir ein Groschen auf. ❯ Der Mensch ist doch sehr hormonisch. ❯ Hausschuhabschluss ❯ Damit haben wir schon 3 Fallbeile. ❯ Eine Krähe wäscht die andere. ❯ Der Wink mit dem Faulzahn nach Helen Leuninger, S. 12ff. M5 A u fg a b e n Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
 « | 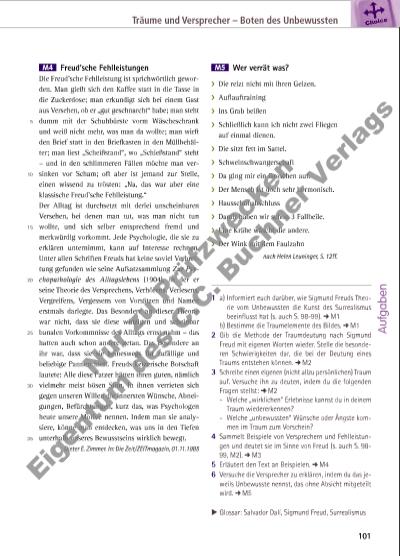 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |