| Volltext anzeigen | |
Palästina: Heiliges Land dreier Weltreligionen 117 Wem gehören Jerusalem und das Heilige Land? Die meisten der überlebenden Kreuzfahrer des Ersten Kreuzzuges sahen ihn mit der Eroberung und militärischen Absicherung der „heiligen Stadt“ Jerusalem als beendet an und kehrten daraufhin nach Westeuropa zurück. Die in Palästina verbliebenen Ritter und adligen Anführer errichteten christliche „Kreuzfahrerstaaten“. Zum religiösen Motiv der Befreiung trat der Anspruch auf Herrschaft hinzu. Dies fand seinen Ausdruck in Bauten wie den Kreuzfahrerburgen und in den neuen Ritterorden der Templer, Johanniter und des Deutschen Ordens, deren Mitglieder sich als „Soldaten Christi“ verstanden. Die Muslime hielten während der beiden Jahrhunderte der Kreuzzüge ebenso rigoros an ihrem Anspruch auf Palästina fest. 1187 eroberte Sultan Saladin von Ägypten (1197 1193) die Stadt Jerusalem zurück (u M5). Er gilt seither in der islamischen Welt als größter Held seit dem Propheten Mohammed. Nach einer christlichen Rückeroberung fiel Jerusalem 1244 endgültig an eine ägyptische Söldnertruppe, 1291 war auch der letzte christliche Stützpunkt im „Heiligen Land“, Akkon, unter islamischer Kontrolle. Seither betonten die Muslime die Bedeutung ihrer heiligen Stätten in Jerusalem, dem Felsendom und der al-Aqsa-Moschee, als religiöse und politische Symbole. Sie standen für die Abwehr der christlichen Europäer und für den Herrschaftsanspruch des Islam über Palästina. Nachwirkungen der Kreuzzüge Die Kreuzzüge im Nahen Osten endeten mit der Vertreibung der christlichen Eroberer. Dafür blieb die Kreuzzugsidee in Europa lebendig – bei der gewaltsamen Bekehrung von Slawen und Balten, der Verfolgung von Ketzern und während des Kampfes gegen die muslimische Herrschaft in Spanien. Regelmäßig wurde der Begriff in der Frühen Neuzeit für die Abwehrkriege gegen die in Südosteuropa vordringenden muslimischen Osmanen verwendet. Der Begriff weckte stets eine Mischung aus Angst vor grausamen Angriffen und der Überzeugung kultureller Überlegenheit gegenüber den Ungläubigen. Als die Türken erfolgreich abgewehrt waren, sahen viele im Abendland darin einen späten Sieg der Kreuzfahrer und sich selbst als die Erben und Nachfolger jener in ihren Augen tief gläubigen und heldenhaften Kämpfer. Die Furcht vor den muslimischen Türken wich im 18. Jahrhundert einem Gefühl der Geringschätzung, auch wenn man von ihrer exotischen Kultur zugleich fasziniert war. Die muslimische Welt vergaß die Kreuzzugszeit, die Eroberungslust und Habgier der Eindringlinge aus dem Abendland, nie. Spätere Auseinandersetzungen mit christlichen Mächten wurden auf die Kreuzzüge bezogen und als typisch für die christlich-westliche Welt angesehen. So wurde und wird bis heute aktuelles Handeln mit dem Schlagwort oder Kampfbegriff „Kreuzzug“ gerechtfertigt oder kritisiert. Dschihad (Jihâd, arab. „Bemühung“, „Anstrengung“, „Kampf“): religiöse Verpflichtung für alle Muslime; allgemein das persönliche Bemühen um den Glauben, speziell der Kampf für die Verteidigung oder Ausbreitung des Islam u Ein Christ wird von Muslimen enthauptet. Illustration in einer Kreuzzugschronik, 14. Jh. Das Feindbild Islam sollte der Kreuzzugsidee Nachdruck verleihen. Auf der Säule sitzend schaut ein „heidnisches Götzenbild“ zu. N u r z P rü zw e c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
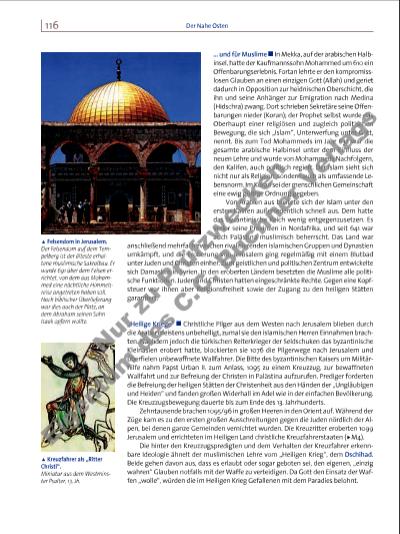 « | 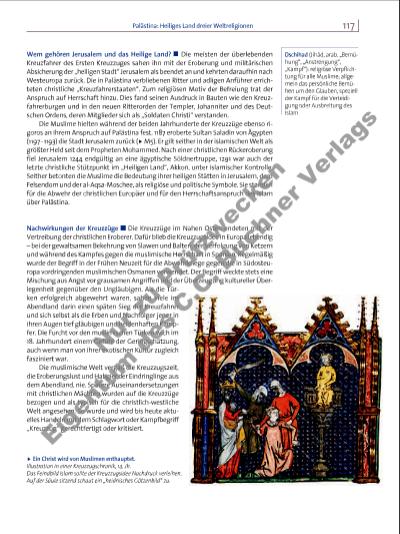 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |