| Volltext anzeigen | |
• Die chinesischen Bürger hatten immer häufiger mit Korruption und einer als ungerecht empfundenen Besteuerung zu kämpfen, was ebenfalls zu Unruhen führte. • Hinzu kamen Kämpfe zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen innerhalb des Vielvölkerstaates China. • 1850 bis 1864 fand der Aufstand einer radikal-religiösen, anti-mandschurischen Rebellengruppe aus dem Süden Chinas statt, die ein „Himmlisches Reich des Großen Friedens“ („taiping tianguo“, daher „Taiping-Aufstand“) errichten wollten. Er schwächte die mandschurische Qing-Dynastie. Zeitweise hatten die Rebellen fast ein Drittel des Reiches unter ihre Kontrolle gebracht; geschätzte 30 Millionen Menschen fanden in dem Bürgerkrieg den Tod. Erster Opiumkrieg (1839 1842) Von außen wurde das Reich durch die aggressive Handelsund Expansionspolitik europäischer Kolonialmächte in seiner Souveränität eingeschränkt. Seit dem 18. Jahrhundert hatten sich die europäischen Mächte, allen voran Großbritannien, bemüht, den Handel mit China auszuweiten. Diese Versuche stießen jedoch auf Ablehnung seitens der chinesischen Regierung, die den Handel mit dem Westen auf den Hafen Kanton beschränkte. Dort wurden in erster Linie chinesische Waren gegen Silber gehandelt. Im 19. Jahrhundert begann die britische Ostindienkompanie mit der Einfuhr von Opium aus Indien nach China, was nicht nur zehntausende Chinesen drogenabhängig machte, sondern auch die chinesische Handelsbilanz negativ beeinflusste, denn nun flossen große Mengen Edelmetall aus China ab. Hinzu kam eine generelle Ausweitung des illegalen Handels, sodass sich Lin Zexu, der Sonderkommissar der chinesischen Regierung, im Jahr 1839 veranlasst sah, den kompletten Opiumbestand in Kanton zu vernichten (u M2). Großbritannien entsandte daraufhin eine Kriegsflotte nach China – der erste Opiumkrieg hatte begonnen. „Ungleiche Verträge“ und Boxeraufstand Die militärische Überlegenheit Großbritanniens führte dazu, dass China den Krieg verlor und im Vertrag von Nanking zur Öffnung Kantons und fünf weiterer Häfen für den internationalen Handel verpflichtet wurde. Außerdem wurden Entschädigungszahlungen und die Abtretung Hongkongs an Großbritannien – in dessen Besitz es bis 1997 verblieb – erzwungen (u M3). Im Laufe der nächsten Jahrzehnte folgten weitere militärische Interventionen und Demütigungen durch europäische Mächte sowie zusätzliche „ungleiche Verträge“, die unter anderem die Legalisierung des Opiumhandels und die Öffnung mehrerer Häfen diktierten. Darüber hinaus verlor China Teile seiner Peripherie an die Kolonialreiche Russlands, Großbritanniens und Frankreichs. Im Jahr 1900 zeigte sich die Schwäche der Qing-Dynastie einmal mehr, als der von der Regierung unterstützte „Boxeraufstand“ von internationalen Truppen niedergeschlagen und im sogenannten „BoxerProtokoll“ die Souveränität Chinas weiter beschnitten wurde. China und Japan im 19. Jahrhundert 211 i Britischer Opiumhandel. Französische Karikatur, 1840. „Ich sage Ihnen, Sie müssen dieses Gift unverzüglich kaufen, wir wollen, dass Sie sich wirklich vergiften, sodass wir genug Tee haben, um unsere Beefsteaks angenehm zu verdauen.“ Boxeraufstand: westliche Bezeichnung für die Ausschreitungen der radikalen Yihetuan („Faustkämpfer für Recht und Harmonie“) gegen chinesische Christen und westliche Gesandte um 1900. Eine Strafexpedition unter deutschem Oberbefehl antwortete mit Exekutionen, Plünderungen und Verwüstungen. Vielvölkerstaat China: China bestand im 19. Jahrhundert aus den „Staatsvölkern“ der Mandschu, Mongolen und Han-Chinesen, wobei letztere mit 95 Prozent in der Mehrzahl waren, jedoch für sich keine homogene Gruppe bildeten. Hinzu kamen viele ethnische Minderheiten wie Tibeter, Dsungaren oder muslimische Turkvölker. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
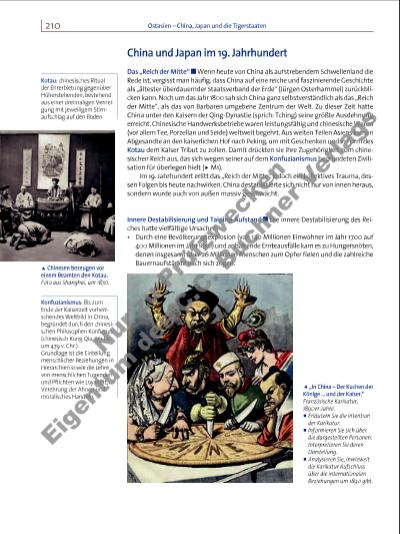 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |