| Volltext anzeigen | |
Wirtschaft in der Feudalgesellschaft 77 Städte als Zentren neuer Wirtschaft Schon im Frühmittelalter, als in vielen ehemaligen Römerstädten wieder städtisches Leben begann, siedelten sich dort spezialisierte Handwerker und Kaufleute an. Ihre nichtagrarische Lebensweise machte sie vom Import von Lebensmitteln aus dem Umland abhängig. Seit Anfang des 12. Jahrhunderts förderten weltliche und kirchliche Landesherren die Neugründung von Städten in ihren Territorien. Stadtbürger hatten Besitzund Erbrecht, konnten einen Rat wählen und unterhielten eigene Gerichte. Manche Städte konnten nach harten Kämpfen die Herrschaft ihres Stadtherrn beseitigen.* Das Modell „Stadt“ war erfolgreich, da die Stadtherren am Zoll, am Warenumsatz auf dem täglichen Markt und am Stapelrecht (Pflicht zum Warenangebot durchziehender Kaufleute) verdienten. Handwerk und Handel erfuhren in den Städten einen großen Aufschwung. Dies führte zu einer sozialen Differenzierung der Bevölkerung der Stadt: Die erfolgreichsten Kaufleute und einige reiche Handwerker waren bald vermögender als das „Patriziat“, die alteingesessene Oberschicht aus Ortsadel und Ministerialen, die den Rat der Stadt dominierte. Das wichtigste wirtschaftliche Element der Stadt war der Markt, auf dem Waren des Umlandes und Erzeugnisse städtischer Handwerker zum Konsum und Weiterverkauf angeboten wurden. Aus den Märkten bedeutender Handelsstädte entwickelten sich jährlich zu bestimmten Zeiten abgehaltene Messen, die Anund Verkäufer aus einem weiten Einzugsbereich anlockten. Bedeutende Messestädte des Mittelalters waren Antwerpen, Deventer, Köln, Frankfurt und Leipzig. Ein weiterer ökonomischer Faktor der Stadt war das Handwerk, das in Spezialisierung, Produktpalette und Reichweite das dörfliche Hauswerk weit übertraf.** Die städtischen Handwerker schlossen sich, nach Gewerben gegliedert, zu Zünften zusammen. Dies sollte sie vor der Übermacht des Patriziats einerseits und dem Zuzug konkurrierender Gewerbetreibender andererseits schützen. Mit dem Zunftzwang regulierten die etablierten Handwerksmeister den Markt und hielten ihre Gesellen in Abhängigkeit. Er blieb in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Städte waren Zentren der Textilproduktion; in Flandern haben sie sich auf Wolltuche, am Bodensee und in Westfalen auf Leinwand spezialisiert. Seit 1360 wurde in schwäbischen Städten in großem Umfang Tuch aus importierter Baumwolle sowie Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen (Barchent) gewebt. Das Metallgewerbe erfuhr eine breite Auffächerung. Handwerker spezialisierten sich auf besondere Materialien (Eisen, Messing, Edelmetalle) sowie Endprodukte (Drähte, Bleche, Gefäße, Messer, Waffen, Schmuck usw.). Die Stadt Nürnberg wurde berühmt für ihre mechanischen Geräte, für Rüstungen und Spielwaren (u M3). Die Hanse und die oberdeutschen Städte Seit Gründung der Stadt Lübeck im Jahr 1143 bemühten sich norddeutsche Kaufleute, ihre riskanten Unternehmungen zur See abzusichern und ihre Position in den Zielhäfen zu stärken. Aus der „Gemeinschaft der Gotlandfahrer“ ging die Kaufleutehanse hervor, ein Verband von Unternehmern mit gleichen Interessen. Als Genossenschaft erreichte man an mehreren Orten Steuerbefreiung, eigene Gerichtsbarkeit und Gleichstellung mit den einheimischen Händlern. Die Hanse konnte dauerhafte Handelsbüros (Kontore) und feste Lagerhäuser für ihre Waren errichten. Sie etablierte ein Netz von dauernd befahrenen Handelsrouten, in das auch das produzierende Hinterland einbezogen wurde. Zunftzwang: Kopplung der Ausübung eines Handwerks an die Aufnahme in die entsprechende Zunft i Ein Händler wiegt seine Waren. Relief von 1476 an der Stadtwaage in Nürnberg. Der Waagenmeister (Mitte) überwacht den Vorgang, sein Gehilfe (links) legt Gewichtsstücke auf die Waage. Der Kaufmann (rechts) muss für die Wägung bezahlen, dafür bekommt seine Ware ein städtisches Siegel, das ihr Gewicht amtlich bestätigt. i Darstellung einer Kogge. Stadtsiegel von Stralsund, 14. Jh. Das typische Handelsschiff der Hanse war die Kogge, ein bauchiges Segelschiff mit starkem Ruder und befestigtem Heck. * siehe S. 24 ** siehe S. 25 und 28, M7 N u r zu P rü fz w e c n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
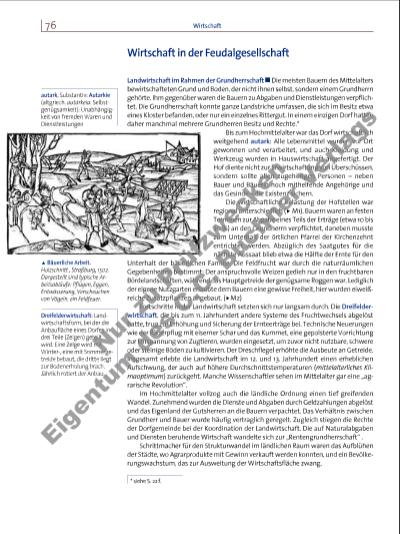 « | 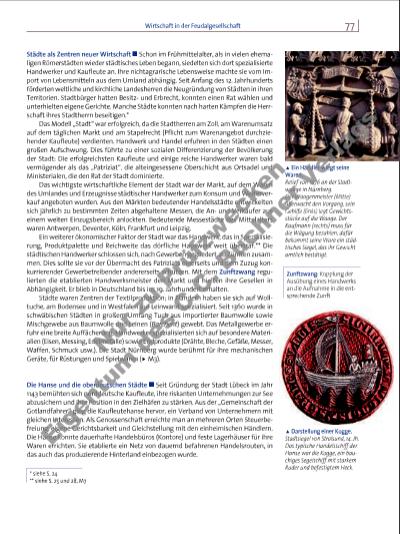 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |