| Volltext anzeigen | |
Wirtschaft in der Feudalgesellschaft 79 Produktionsmittel und Innovationen Neben Zugtieren waren Wasserund Windmühlen die einzigen mechanischen Kraftquellen. Sie wurden zum Mahlen von Getreide genutzt, später auch für die Entwässerung im Bergbau, in der Metallurgie und im Textilgewerbe. Innovationen des Mittelalters führten zur Herausbildung spezialisierter Berufe. Die Herstellung von Tuch wurde durch Einführung des horizontalen Webstuhls, dessen Bedienung mehrere qualifizierte Personen erforderte, vom ländlichen Nebenerwerb zum Gewerbe städtischer Handwerker. In vielen Städten bildeten sich Leinenund Wollweberzünfte, das städtische Umland wurde oft von der Textilproduktion geprägt. Ähnliche Wirkung hatten Neuerungen bei der Glasund Keramikfertigung. Die Dynamik der Städte führt auch zu neuen Berufen im Bereich der Kommunikationsmittel: 1390 wird in Nürnberg die erste Papiermühle im Reich errichtet, 1448 in Mainz die erste Druckerei, um 1500 gab es Druckereien bereits in über 60 Städten. Als Einnahmequelle für den Landesherrn waren Bergwerke wichtig, die Silber, Kupfer, Zinn und Eisen erbrachten. Die Investitionen für solche Unternehmen waren hoch und rentierten sich im Erfolgsfall erst spät. Dort, wo man auf ergiebige Lagerstätten stieß, entwickelten sich frühe Industriereviere, etwa in der Oberpfalz, in der im 14. Jahrhundert neben Eisenerzgruben auch Hunderte frühe Hochöfen und wassergetriebene Hammerwerke betrieben wurden. Der gewaltige Bedarf an Brennholz und Holzkohle verursachte in den Revieren massive, bereits für die Zeitgenossen sichtbare Umweltschäden. Die ursprünglich kaiserlichen Silbergruben bei Goslar gelangten seit 1360 in den Besitz der Stadt und begründeten deren Reichtum. Die Wirtschaftskrise im Spätmittelalter Der wirtschaftliche Aufschwung Europas hatte den Anteil der Bevölkerung erhöht, die nicht im primären Sektor tätig war. Entsprechend rentabel war die Landwirtschaft, die durch Binnenkolonisation immer mehr ausgedehnt wurde. Das Wirtschaftssystem geriet in Schieflage, als sich infolge einer Klimaveränderung seit Anfang des 14. Jahrhunderts Missernten und Hungersnöte zu häufen begannen. Zwischen 1347 und 1352 erfasste dann die Pest wie ein Lauffeuer fast ganz Europa. Etwa ein Drittel der Bevölkerung fiel dem „Schwarzen Tod“ zum Opfer. Die Nachfrage nach Getreide sank beträchtlich, was zur Aufgabe zahlreicher Höfe und Dörfer führte (Wüstungsprozess). Dagegen wurde Arbeitskraft vermehrt nachgefragt, besonders in den Städten, die große Bevölkerungsverluste zu beklagen hatten. Eine Wanderung in die Städte (Landflucht) war die Folge, durch die der dortige Arbeitskräftemangel ausgeglichen wurde. Während so die Bürger ihre Lebensweise weitgehend beibehalten konnten, wurde der niedere Adel, der von den Erträgen seiner Rittergüter (Grundrenten) abhängig war, besonders hart getroffen. Manchem Neubürger einer Stadt gelang es, durch Ehrgeiz und Erfolg bis in das Patriziat aufzusteigen. Zu diesen Erfolgreichen gehört die Familie der Fugger, die seit der Einwanderung des Landwebers Hans Fugger nach Augsburg 1367 in drei Generationen ein europaweit tätiges Handelsimperium schufen (u M4). Durch die Agrarkrise des 14. Jahrhunderts sank der Anteil des Faktors Boden am Gesamtprodukt der Wirtschaft, während der Anteil des Kapitals und der Arbeit stieg. Dies erhöhte die Bedeutung von Handel und Kreditwesen und trug zur Entwicklung des Frühkapitalismus bei. Er blieb auf die Schicht des städtischen Patriziats beschränkt, das große Kapitalmengen umsetzte. Zur Sicherung der Investitionen entstanden um 1600 Handelsgesellschaften, die vor allem im Kolonialhandel aktiv waren.* Binnenkolonisation (Landesausbau): Erschließung bislang unbewohnter oder siedlungsarmer Regionen im Innern eines Herrschaftsgebietes Frühkapitalismus: Wirtschaftsform, deren Erträge nicht aus Landbesitz, sondern aus Besitz von Geld und Produktionsmitteln stammen primärer Sektor, „Urproduktion“: Wirtschaftsbereich, in dem Rohstoffe gewonnen werden n Präsentation: Gestalten Sie ein Poster über den Wandel der Feudalgesellschaft im Laufe des Mittelalters. Tragen Sie wichtige Begriffe aus dem Darstellungstext ein, suchen Sie nach geeigneten Illustrationen und erläutern Sie damit den Transformationsprozess. i Entwässerung einer Mine. Holzschnitt, um 1500. Grubenwasser konnte im mittelalterlichen Bergwerk nur mit Muskelkraft gefördert werden. * siehe S. 82 f. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
 « | 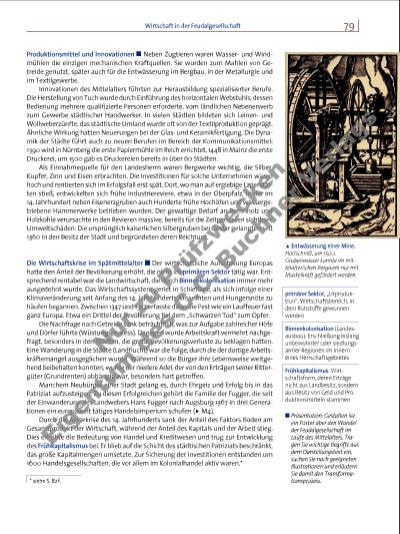 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |