| Volltext anzeigen | |
83 a I n f o s e i t e S t o a I n f o s e i t e S t o a I n f o s e i t e S t o a I n f o s e i t e S t o a Philosophie am Wendepunkt Das klassische Griechenland war niemals ein Reich im modernen Sinne des Wortes gewesen. Was wir heute als Griechenland kennen, war damals eine Gesamtheit von unabhängigen Stadtstaaten, die häufig Kriege gegeneinander führten. Die Bürger einer jeden Polis waren stolz darauf, zu ihrer Stadt zu gehören, und die Religion spielte eine wichtige Rolle im bürgerlichen Leben. […] Alexander der Große (gest. 323 v. Chr.) hat diese Welt grundlegend verändert. Dieser geniale Feldherr eroberte fast alle griechischen Städte, dazu das riesige Persische Reich, und vereinigte diese Gebiete unter seiner Herrschaft. Sein politisches Ideal war nicht mehr die klassische Polis, sondern das Weltreich. Dabei war Alexander eigentlich gar kein Grieche; er war ein nach griechischem Vorbild erzogener mazedonischer Barbar (vom griechischen bárbaros, „Nichtgrieche“). Kurz, Alexan der zerstörte die politische Struktur der klassischen griechischen Welt. Infolge dieses grundlegenden politischen Wandels gerieten die Griechen in immer engeren Kontakt mit den Sitten und Gebräuchen anderer Völker […]. In dieser Situation beschäftigten sich die Philosophen überwiegend mit praktischen, besonders mit ethischen Fragen. Auf den Verfall der klassischen griechischen Welt reagierten die Philosophen also mit einem immer größeren Interesse für die Kunst des guten Lebens, für die Kunst, glücklich zu sein. […] Obgleich es keinem der Nachfolger Alexanders ge lang, das gesamte Reich – es erstreckte sich von Griechenland und Ägypten bis zu den Grenzen Indiens – unter seiner Herrschaft zu vereinigen, so wurde die klassische Welt doch nie wieder zu dem, was sie einmal gewesen war. Eine weltbürgerliche Gesinnung, aber auch der Skeptizismus und ein pessimistisches Lebensgefühl bemächtigten sich mehr und mehr der antiken Welt. Vor diesem Szenario betritt die stoische Philosophie die Bühne. Héctor Zagal/José Galindo, S.118f., 125 5 10 15 20 25 30 35 Einheit von Welt und Gott(-heit) Die Stoiker neigen zum Pantheismus, d. h. zu der Auffassung, dass das ganze Universum von Gott durchdrungen ist: Alle Dinge sind miteinander verknüpft, und fast nichts ist einander fremd. Alles Geschaffene ist in der Welt harmonisch einander zugeordnet. Denn es gibt nur eine Welt, die alles in sich vereint, einen Gott, der alles durchdringt, eine Materie, ein Gesetz, eine Vernunft, die allen vernünftigen Geschöpfen gemeinsam ist, und eine Wahrheit, wie es ja auch nur eine Vollkommenheit für all die verwandten Wesen gibt, die an der selben Vernunft teilhaben. Marc Aurel. In: Wolfgang Weinkauf (Hrsg.), S. 129 Stoa-Lexikon Adiaphora (griech. Gleichgültigkeit): gleich gültige Dinge, von relativem Wert Apathia (griech. Unempfindlichkeit): Leidenschaftslosigkeit als sittliches Bildungsideal zur Ausschaltung der Affekte Ataraxia (griech. Unerschütterlichkeit): Seelenruhe und Gleichmut als Vorbedingung der Glückseligkeit Autarkie (griech. Selbstgenügsamkeit): Selbständigkeit, äußere und innere Unabhängigkeit von allem, was Leid erzeugen kann Logos (griech.): zentraler Begriff der griechischen Philosophie: Wort, Rede, Lehre, Vernunft, im übertragenen Sinne auch Grundsatz, Sinn, Weltgesetz secundum naturam vivere (lat. nach/gemäß der Natur leben): mit der Logos-Natur in Einklang stehendes tugendhaftes Leben stoisch: von unerschütterlicher Ruhe, gleichmütig, gelassen Glossar: Affekt, Marc Aurel, Epiktet, Seneca, Skeptizismus, Tugend Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc ne r V er la gs | |
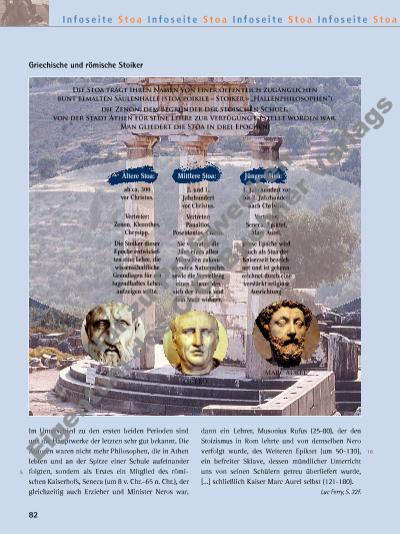 « | 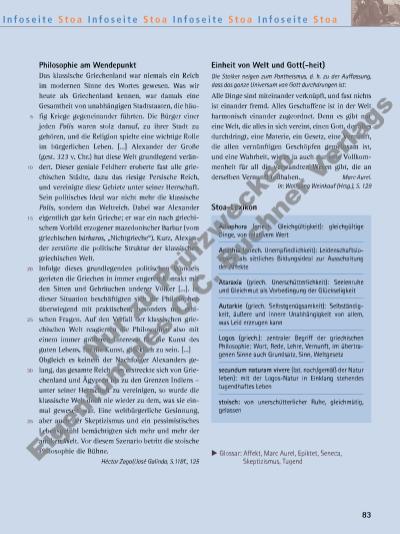 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |