| Volltext anzeigen | |
Der gute Wille 93 chen; allein es fehlt viel daran, um sie ohne Einschränkung für gut zu erklären (so unbedingt sie auch von den Alten gepriesen worden). Denn ohne Grundsätze eines guten Willens können sie höchst böse werden, und das kalte Blut eines Bösewichts macht ihn nicht allein weit gefährlicher, sondern auch unmittelbar in unsern Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dafür würde gehalten werden. Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zu Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d. i. an sich gut, und, für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zu Gunsten irgendeiner Neigung, ja, wenn man will, der Summe aller Neigungen, nur immer zu Stande gebracht werden könnte. Wenngleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, seine Absicht durchzusetzen; wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille (freilich nicht etwa ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, so weit sie in unserer Gewalt sind) übrig bliebe: so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat. Die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesem Werte weder etwas zusetzen noch abnehmen. Sie würde gleichsam nur die Einfassung sein, um ihn im gemeinen Verkehr besser handhaben zu können, oder die Aufmerksamkeit derer, die noch nicht genug Kenner sind, auf sich zu ziehen, nicht aber, um ihn Kennern zu empfehlen und seinen Wert zu bestimmen. Immanuel Kant, S. 393f. Beispiel: So sind z. B. Mut und Entschlossenheit für einen Kriminalkommissar unentbehrliche gute Eigenschaften, bei einem Bankräuber hingegen sind sie äußerst böse und schädlich. 2. Teil des Begründungsverfahrens: Was sind die Bedingungen für den guten Willen? Antwort: Der gute Wille darf weder nach seinen Wirkungen noch als Mittel für eine bestimmte Wirkung beurteilt werden. Denn er ist an sich gut, d. h. allein gut durch das gute Wollen. Folgerung: Daher hat er auch nicht sein Gutsein durch etwas, was außer ihm liegt, und sei es auch eine gute Wirkung. Problem: So würde ein guter Wille, auch wenn er gar nichts bewirkt, seinen vollen Wert in sich selbst haben. Folgerung: Wenn das so ist, dann kann das Gute eines guten Willens auch nicht vom Erfolg oder Misserfolg beim Erreichen der Wirkungen hergeleitet werden. Ein faktisch erreichter Nutzen ist lediglich eine „Einfassung des Juwels“. 1 Der Text ist in Sinnabschnitte gegliedert. Formuliere zu jedem Abschnitt die Frage, auf die der Text antwortet. 2 Fasse die wichtigen Aussagen des Textes in Form von Thesen zusammen. Erläutere jede These. Dazu kannst du 1. auf den Text und den Kommentar zurückgreifen, 2. die Gegenthesen ausformulieren und evtl. widerlegen, 3. anhand von Beispielen die Thesen illustrieren. Glossar: Affekt A u fg a b e n Thesen formulieren In einer These (griech. thésis: aufgestellter Satz, Behauptung) wird ein bestimmter Sachverhalt oder Zusammenhang behauptet. Thesen sollten in kurzen und prägnanten Sätzen formuliert werden. Es ist auch erlaubt, die aufgestellten Sätze zuzuspitzen, um die eigene Position besonders zu verdeutlichen. Stehen auf einem Blatt mehrere Thesen, spricht man von einem Thesenpapier. Johannes Rohbeck, S. 189 M E T H O D E 30 35 40 45 50 55 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d s C .C . B uc hn er V er la gs | |
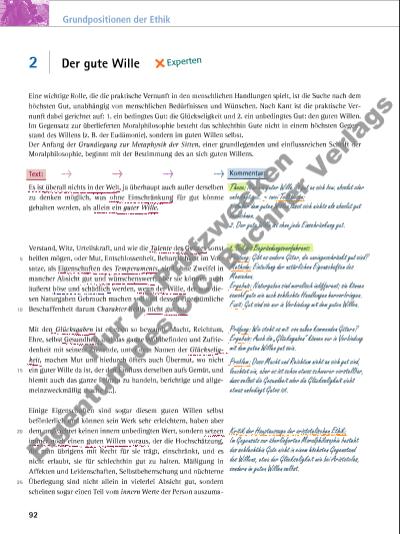 « | 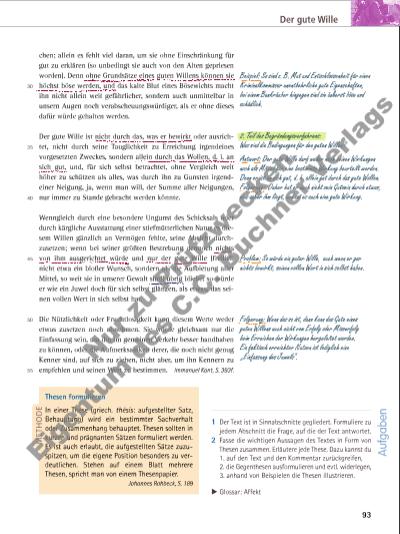 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |