| Volltext anzeigen | |
97 Entstehung und Bedeutung des Utilitarismus 1789, im Jahr der Französischen Revolution und nur ein Jahr nach Kants Kritik der praktischen Vernunft, begründet in England Jeremy Benthams Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung eine neue Richtung der Moralphilosophie: den Utilitarismus (engl. utilitarianism). Kants Pflichtenethik und der Utilitarismus prägen bis zum heutigen Tag die Diskussionen in der Moralphilosophie. In scharfem Gegensatz zu Kant sieht Bentham den Maßstab einer moralisch guten Handlung nicht in dem ihr zugrunde liegenden guten Willen, sondern allein in ihrem Nutzen – gemessen an ihren Handlungsfolgen. Der Be griff des Nutzens wird dabei zunächst als Lust definiert. Während Bentham nur quantitative Kriterien der Lustempfindung gelten lässt, berücksichtigt John Stuart Mill auch die Qualität oder Beschaffenheit einer Lust. Ulrich Plessner, S. 63 Folgenethik Da im Utilitarismus die Handlungen nach ihren Folgen beurteilt werden, handelt es sich um eine konsequenzialistische oder Folgenethik. Utilitarismus heute Der australische Philosoph Peter Singer (*1946) gilt als einer der prominentesten Vertreter des zeitgenössischen Utilitarismus. In seinem Hauptwerk Praktische Ethik (1979) entfaltet er seine Position des Interessenoder Präferenzutilitarismus, dessen Wertbasis nicht mehr die Maximierung von Lust, sondern die maximale Erfüllung von Interessen ist. Dabei stellt er die Fähigkeit zu leiden (und sich zu freuen) als die entscheidende Eigenschaft heraus, die einem Lebewesen Anspruch auf gleiche Interessenabwägung verleiht. Insofern seien z. B. Versuche an hö heren Tieren moralisch verwerflich, weil diese Tiere leiden können, während Experimente mit menschlichen Embryonen moralisch nicht verwerflich seien – weil diese kein Überlebensinteresse hätten. Singers utilitaristische Schlussfolgerungen zum Thema Sterbe hilfe (Euthanasie) riefen insbesondere in Deutschland scharfe Kritik hervor. Singer lehrt an den Universitäten Princeton/USA und Melbourne/Australien. nach Ulrich Plessner, S. 63 5 10 15 5 10 15 20 Lexikon des Utilitarismus U t i l i t a r i s m u s I n f o s e i t e U t i l i t a r i s m u s I n f o s e i t e U t i l i t a r i s m u s Hedonismus (griech. Freude, Lust): lehrt, dass das Streben nach Lust das menschliche Handeln und Verhalten bestimmt bzw. bestimmen sollte hedonistisches Kalkül: Instrument, das Jeremy Bentham zur Messung des sozialen Nutzens von Handlungen entwickelt hat hedonistisches Prinzip: Maßstab der moralischen Be urteilung einer Handlung ist das durch diese Hand lung erzielte Glück klassischer Utilitarismus: der Nutzen wird als Lust oder subjektives Wohlbefinden definiert Präferenz (frz. Vorzug, Vorliebe): Wünsche, Interessen, Vorlieben Präferenzutilitarismus: definiert den Nutzen nicht als innere Befindlichkeit (Lust, Freude oder Glück), sondern als objektive Erfüllung von Präferenzen qualitativer Hedonismus: qualitative Bestimmung des Nützlichkeitsbegriffs nach John Stuart Mill; unterscheidet qualitativ verschiedene Arten von Lust (niedere und höhere Freuden) quantitativer Hedonismus: rein quantitative Glücksund Nützlichkeitsbestimmung nach Jeremy Bentham; Lust und Unlust sollen exakt gemessen und die gemessenen Werte miteinander verglichen werden Utilität (lat. nützlich): Nutzen, Nützlichkeit Utilitätsprinzip: Nutzenprinzip; Maßstab für Beurteilung der Folgen einer Handlung ist der Nutzen für das, was als an sich gut erachtet wird Universalisierung: Verallgemeinerung universalistisches Prinzip: Maßstab für den moralischen Wert einer Handlung ist das Wohlergehen aller von der Handlung Betroffenen Glossar: Aufklärung, Logik Nu zu P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V rla gs | |
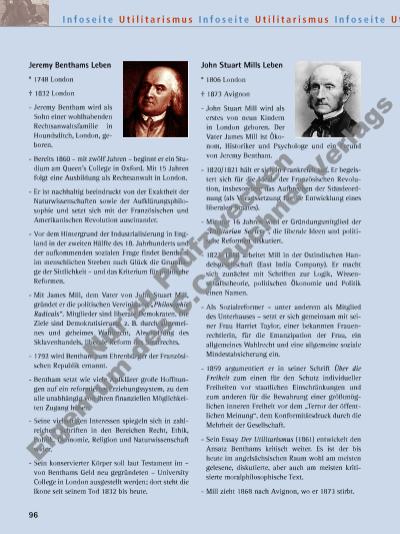 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |