| Volltext anzeigen | |
115Mit Material arbeiten 5 10 15 20 5 10 15 5 10 15 M 1 Wormser Reichstag: Martin Luther vor Karl V. Briefmarke der Deutschen Bundespost von 1971. Die Bildvorlage geht auf einen Holzschnitt von 1577 zurück. M 2 Luther und Karl V. in Worms Als Luther am 18. April 1521 auf dem Reichstag aufgefordert wird, seine Lehren zu widerrufen, begründet er seine Ablehnung angeblich so: Wenn ich aber nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien, allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nicht, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Auf Luther antwortet Kaiser Karl V.: Ihr wisst, dass ich von den allerchristlichsten Kaisern der edlen deutschen Nation, den katholischen Königen von Spanien, den Erzherzögen von Österreich und den Herzögen von Burgund abstamme, die alle bis zu ihrem Tod treue Söhne der katholischen Kirche gewesen sind […]. Deshalb bin ich entschlossen, alles zu halten, was meine Vorgänger und ich bis zum gegenwärtigen Augenblick gehalten haben […]. Denn es ist sicher, dass ein einzelner Bruder in seiner Meinung irrt, wenn diese gegen die der ganzen Christenheit, wie sie seit mehr als tausend Jahren und heute gelehrt wird, steht, denn sonst hätte ja die ganze Christenheit heute und immer geirrt. Erster Text: Martin Luther, Werke, Bd. 7, Weimar 1897, S. 837 f. (vereinfacht) Zweiter Text: Fritz Dickmann (Bearb.), Renaissance, Glaubenskämpfe, Absolutismus, München 21976, S. 126 M 3 Die Reformation „von unten“ In Wittenberg beginnen die Anhänger Luthers 1521, die neuen Vorstellungen umzusetzen. Ein Zeitgenosse berichtet: Der Propst* zu Wittenberg hat Erich Saltes Tochter zu Ehe genommen. Ein Barfüßermönch** ist ein Schuster geworden und hat eines Bürgers Tochter genommen. Ein anderer Barfüßer ist ein Bäcker geworden und hat eine Frau genommen. Ein Augustiner ist ein Schreiner geworden und hat eine Frau genommen. Dr. Feldkirch hat seine Köchin genommen. Der Rat zu Wittenberg hat den Barfüßern und Augustinern gesagt, sie sollen ihre Klöster räumen, und hat alle Wertsachen in den Klöstern aufgezeichnet. Der Rat hat 14 Männer eingesetzt und verordnet, dass alle armen Leute erfasst werden sollen. Sie seien von den eingezogenen geistlichen Gütern zu versorgen. Die Pfarrkirche steht alle Tage zu; nur am Sonntag hält man eine deutsche Messe darin und predigt, und das Volk geht eifrig zum hochwürdigen Sakrament und nimmt es selbst auf dem Altar. Allenthalben lassen die Mönche und Pfaffen ihre Kopfhaare wachsen und nehmen sich Eheweiber. Karl Kaulfuß-Diesch (Hrsg.), Das Buch der Reforma tion, Leipzig 21917, S. 287 f. (vereinfacht) * Propst: Vorsteher, Aufseher einer kirchlichen Ein richtung ** Barfüßermönch: Die Angehörigen des Franziskaner-Ordens gingen aus Demut und Enthaltsamkeit barfuß oder trugen Sandalen. M 4 Die Reformation „von oben“ Der Landgraf Philipp von Hessen notiert sich im Januar 1527 auf einem „Merkzettel“, wo rauf er im Zusammenhang mit der Ein führ ung der Reformation achten will. Ferner ist in Marburg eine Ordnung zu erstellen, die Messe und Zeremonien betreffend. Ferner ist zu berücksichtigen, dass man der Armen gedenke und zu diesem Zweck die Bruderschaften, Spitäler und Stiftungen heranziehe. Ferner ist es nötig, mit dem Rat der Richter Aufsichtsbeamte einzusetzen, die überall gute Prediger einsetzen und die schlechten absetzen. Ferner ist an die Spitäler zu gedenken. Ferner ist hier in Marburg eine Universität zu errichten. Ferner haben die Aufsichtsbeamten über all Schulen einzurichten und sie mit frommen und gelehrten Lehrern auszustatten und für deren Versorgung zu sorgen. Ferner soll man das Silbergeschirr aus den Klöstern holen, das ich noch nicht eingezogen habe. Zit. nach: Margret Suchier, Das landesherrliche Kirchenregiment Philipps von Hessen, in: Praxis Geschichte H. 3/1990, S. 48 1. Vergleiche M 1 mit dem Gemälde auf Seite 113. Beschreibe die Hauptunterschiede. 2. Arbeite die gegensätzlichen Standpunkte heraus (M 2). 3. Zähle auf, wer von der Reformation betroffen war und was sich durch sie änderte (M 3 und M 4). 4492_1_1_2013_110_133.indd 115 28.02.13 15:01 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V rl gs | |
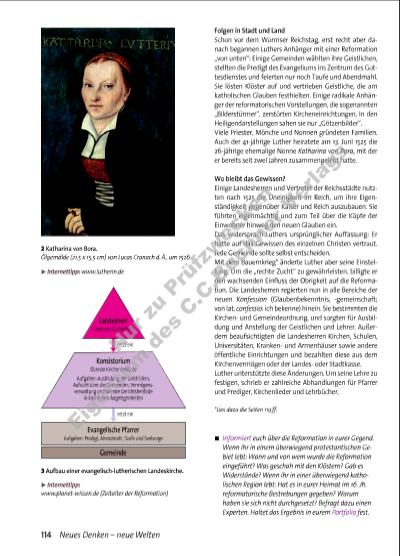 « | 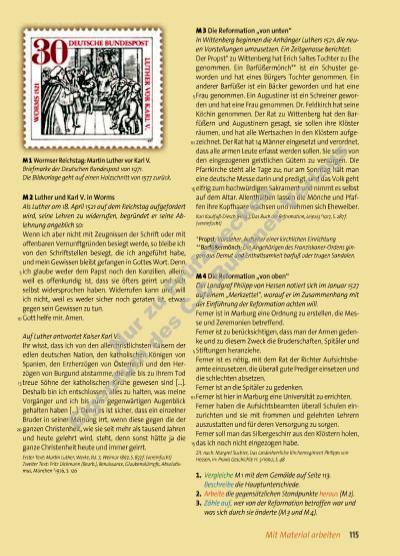 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |