| Volltext anzeigen | |
119Neues Denken – neue Welten Gegen die Obrigkeit Was im Frühjahr 1525 aus dem Schwarzwald gemeldet wurde, klang ungeheuerlich: „In stetten und uf dem Land“ lehne sich der „gemeine Mann“ gegen die Obrigkeit auf. Auch in anderen Gebieten verweigerten Bauern, Angehörige der ländlichen und städtischen Unterschichten sowie Arbeiter der Bergwerke (Bergknappen) ihre Dienste und Abgaben. Mit ihren Geistlichen verfassten sie Beschwerdeschriften. Blieben sie unerhört, schlossen sie sich in „Haufen“ zusammen, um Veränderungen zu erzwingen. Die Aufständischen stürmten Klöster, Schlösser und Burgen, plünderten sie und steckten sie in Brand. Da die Erhebungen meist von den Bauern ausgingen, sprachen schon die Zeitgenossen vom Bauernkrieg. Die Ursachen waren oft von Ort zu Ort verschieden: Die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse waren stetig gesunken. Einige Grundherren hatten versucht, ihre Einkommensverluste durch Ausweitung der Dienste und Abgaben auszugleichen. Am heftigsten wehrten sich die Bauern gegen die Einschränkungen der „alten“ Selbstverwaltungsrechte wie der gemeinsamen Nutzung von Wäldern, Wiesen und Seen (Allmende). Der „gemeine Mann“ lehnte sich auch gegen neue Steuern auf, von denen Adel, Klerus und Beamte meist befreit waren. Hinzu kamen Klagen über die Geistlichen. Ihnen wurde vorgeworfen, Kirchengelder zu verprassen und die Seelsorge zu vernachlässigen. In manchen Gegenden waren diese Klagen über hundert Jahre alt und hatten bereits zu zahlreichen Unruhen geführt. Die Aufständischen beriefen sich dabei auf das „alte Recht“, das wiederhergestellt werden sollte, und auf die von den Reformatoren verkündete christliche Freiheit des „göttlichen Rechts“. Der Bauernkrieg bestand aus einzelnen Aufständen ohne gemeinsame Leitung und ohne einheitliches Ziel. Die einen wollten nur ihre früheren Lebensund Rechtsverhältnisse wiederherstellen. Andere forderten, die Leibeigenschaft aufzuheben und die Klöster zu enteignen. Wenige lehnten die Herrschaft von Adel und Kirche ganz ab und wollten in ihren Dörfern und Städten selbst entscheiden. Wer von den Aufständischen geglaubt hatte, in Luther einen Verbündeten zu fi nden, wurde enttäuscht. Er tadelte zwar die Willkür der Herren, aber noch schärfer verurteilte er den Aufruhr gegen die seiner Meinung nach von Gott gewollte „Obrigkeit“. Anders verhielt sich der um 1490 in Stolberg/Harz geborene Theologe und Pfarrer Thomas Müntzer. Er widersprach Luther und wollte Gottes Reich schon auf Erden verwirklichen. Im Frühjahr 1525 rief Müntzer von Mühlhausen (Thüringen) aus den „gemeinen Mann“ zum Kampf zwischen Gottlosen und Auserwählten auf. Das blutige Ende Die Obrigkeit war angesichts der vielen Aufstände zunächst wie gelähmt. Doch bald schlugen ihre Truppen die Erhebungen nieder. 70 000 Menschen kamen dabei ums Leben. Allein in der Schlacht bei Frankenhausen (Thüringen) fanden am 15. Mai 1525 mehr als 5 000 den Tod. Die Anführer, darunter auch der Reformator Thomas Müntzer, wurden in Mühlhausen hingerichtet. Der letzte Aufstand fand 1526 in Tirol statt. Die „Bilanz“ des Bauernkrieges weist aber nicht nur Opfer auf. In etwa einem Drittel der Aufstandsgebiete kamen danach Reformen in Gang. Sie schränkten die Willkür der Fürsten und Herren ein. 1 „Der Bundtschu …“ Nachträglich kolo riertes Titelblatt einer Schrift von 1514. Der mit Riemen ge bundene Schuh ist seit dem 13. Jh. das Symbol der Bauern. Er steht im Gegensatz zum Stiefel der adligen Ritter. Die Bauern erheben sich 1. Arbeite den Zusammenhang von Reformation und Bauernkrieg heraus. 2. Informiere dich, ob dein Wohnoder Schulort vom Bauernkrieg betroffen war. Berichte der Klasse. ˘ Exkursionstipps: • Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche, Mühlhausen • Thomas-Müntzer-Gedenkstätte St. Marien, Mühlhausen • Panorama Museum, Bad Frankenhausen 4492_1_1_2013_110_133.indd 119 28.02.13 15:01 Nu r z u Pr üf zw ec ke n E ge nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
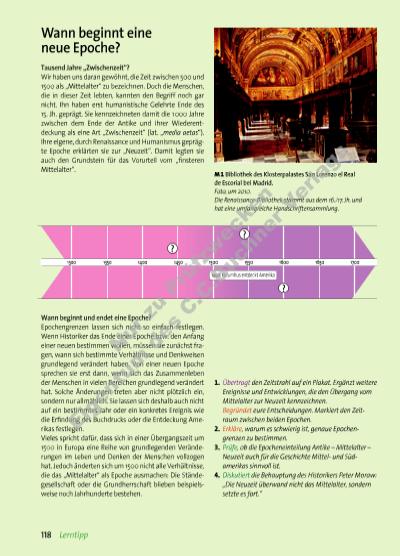 « | 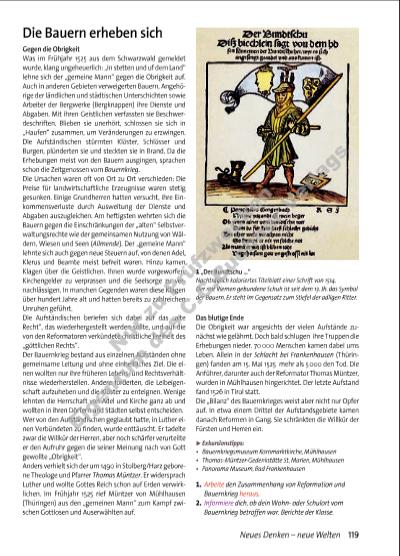 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |