| Volltext anzeigen | |
Ausblick – Mit Material arbeiten 41 1. Beschreibe die Bergung der Bremer Hanse-Kogge. 2. Fasse zusammen, was die Archäologen mit welchen Methoden herausgefunden haben. 3. Stelle fest, woran und womit sich die Seeleute bei ihren Fahrten tagsüber (M 4) und nachts orientieren konnten. Beurteile die jeweiligen Gefahren. ˘ Internettipps: www.dsm.museum (Hansekogge) und www.hanse-kogge.de M 3 Nachbau der Hanse-Kogge von 1380 auf der Ostsee. Foto von Pieter Nijdeken, um 2002. Zweck des in einer Kieler Yachtwerft von 1986 bis 1989 rekonstruierten Schiffes ist es, die offenen Fragen über Mast, Segel, dessen Handhabung sowie die Segeleigenschaften der Koggen in der Praxis zu erforschen. Was der Fund verrät Schiffsarchäologen konnten nun erstmals die genaue Form und Bautechnik einer Hanse-Kogge erforschen, ihre Maße und Tragfähigkeit errechnen. Die Bremer Hanse-Kogge ist 23,3 Meter lang und 7,6 Meter breit, hat einen Laderaum von rund 150 Kubikmetern und konnte etwa 80 Tonnen tragen. Damit ist sie nicht das größte Exemplar des Schiffstyps. Aus alten Schriftstücken geht hervor, dass Koggen des 14. Jh. bis zu 200 Tonnen laden konnten. Dazu fand man heraus, dass die geborgene Kogge noch unvollendet auf der Werft gelegen haben muss, als sie eine Sturmfl ut oder ein Hochwasser weserabwärts riss, denn der Mast fehlte noch. Außerdem wiesen die Forscher nach, dass es auf der Kogge Kajüten für zwölf bis 18 Mann gab. Nur der Kapitän hatte eine Toilette mit Blick nach vorn über das ganze Schiff. Das Baujahr des Fundes bestimmten die Archäologen mit einer Methode zur Datierung von Holz: der Dendrochronologie. Dabei verglichen sie die Jahresringe der gefundenen Eichenbalken mit anderen Eichenproben, deren Fälldatum genau bekannt ist. Wie man weiß, wirken sich die Wachstumsbedingungen wie trockene oder feuchte Jahre, gute oder schlechte Böden einer Baumart auf den Verlauf der Jahresringe aus und bilden eine Art Fingerabdruck. Die Archäologen konnten so feststellen, dass die für die Bremer Hanse-Kogge verwendeten Eichen 1378 gefällt worden waren. Für das Baujahr der Kogge nimmt man daher das Jahr 1380 an. Neue Koggen auf alten Kursen Seit 1991 segeln auf der Nordund Ostsee Nachbauten der Bremer Hanse-Kogge – teilweise wie in alten Zeiten: ohne Karte und Kompass, immer in Sichtweite der Küste, mit dem Lot die Wassertiefe ermittelnd. Nur die offene See überquerten die Schiffe zur Zeit der Hanse nicht am Tag, sondern in der Nacht. Ihren Kurs richteten sie nach dem Polarstern. Koggen schafften im Schnitt fünf bis sechs Knoten in der Stunde (ein Knoten = eine Seemeile = 1,852 Kilometer). Dafür brauchten sie Wind von hinten oder von der Seite. Schräg gegen den Wind konnten Koggen kaum ansegeln. M 4 Loten. Holzstich von 1555. Das Lot hing an einer genau abgemessenen Leine und war am unteren Ende ausgehöhlt. Dort schmierte man etwas Talg oder Wachs hinein. Daran blieb beim Wurf über die Bordwand eine Probe des Bodens haften. Die Bodenprobe, die Farbe des Meeres und die gemessene Tiefe sowie die Ansicht der Küste halfen einem erfahrenen Seemann, den Stand ort der Kogge zu bestimmen. 4492_1_1_2013_026_045.indd 41 28.02.13 14:51 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
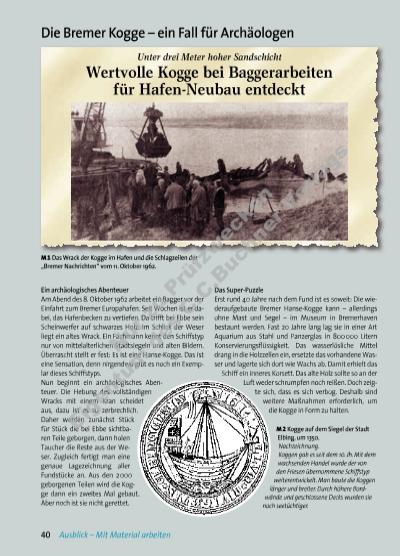 « | 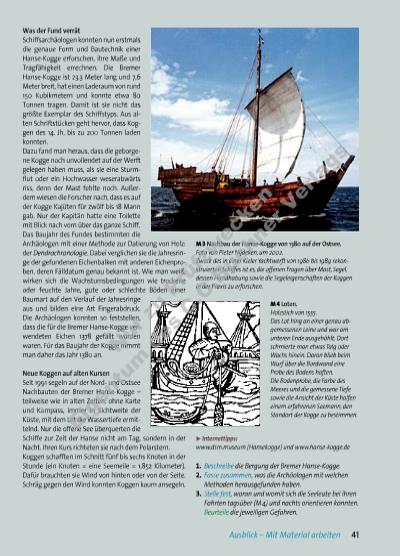 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |