| Volltext anzeigen | |
51Herrschen im Mittelalter ˘ Lesetipp: Maria Regina Kaiser, Karl der Große und der Feldzug der Weisheit, Würzburg 2009 Das weströmische Kaisertum kehrt zurück Das Herrschaftsgebiet der Franken wurde durch die Eroberungen der Karolinger zum größten Reich des heutigen Europa. Im Osten war der byzantinische Kaiser nach wie vor der mächtigste Herrscher. Karl der Große wollte nicht hinter ihm zurückstehen. Zugleich suchte der Papst einen Verbündeten, der ihn vor dem einfl ussreichen Adel in Rom schützen konnte. Weihnachten 800 krönte der Papst Karl den Großen zum Kaiser. Der römische Stadtadel bestätigte die Krönung und damit die Erneuerung des weströmischen Kaisertums. Karl führte danach einen komplizierten Titel: Karl, der al lergnädigste, erhabene, von Gott gekrönte, große und Frieden bringende Kaiser, der das Römische Reich regiert und der auch durch das Erbarmen Gottes König der Franken und Langobarden ist. Der byzantinische Kaiser erkannte Karl den Großen erst nach langen Verhandlungen im Jahre 812 als (zweiten) Kaiser an. Sein Amt sollte nur für den Wes ten gelten, das sogenannte Abendland (lat. occidens: die Länder im Westen). Die antike Kultur lebt wieder auf Karl der Große holte an seinen Hof viele Gelehrte. Zu ihnen gehörten Iren, Angelsachsen, Langobarden und Westgoten. Erst allmählich kamen Franken dazu. Diese Männer beschäftigten sich mit der Antike. Die Sprachenvielfalt im Reich wurde durch das Latein überwunden. Mit ihr konnte der christliche Glauben überall verkündet und einheitlich Recht gesprochen werden. Auch für die Baumeister der Kirchen und Herrschersitze waren römische Vorbilder wichtig. Für seine Kapelle in Aachen ließ Karl Säulen, Mosaike und Bilder aus Italien herbeischaffen. Diese erste Wiederbelebung (lat.-franz.: renaissance) der Antike wurde später Karolingische Renaissance genannt. Karl bemühte sich auch um die Erhaltung der germanischen Dichtung. Er ließ die Heldenlieder und Sagen der Völkerwanderungszeit sammeln und regte eine germanische Grammatik an. 3 „Königshalle“ der karolingischen Reichs abtei Lorsch (Hessen). Foto, um 1980. Das Bauwerk entstand um 800. Die drei Torbögen greifen auf antike Vorbilder zurück. Vermutlich sollen sie den Gedanken der Erneuerung des Römischen Reiches (lat. renovatio imperii) ausdrücken. Das ausgemalte Obergeschoss diente wahrscheinlich als Königs halle, in der der Herrscher Besucher empfi ng, Urkunden ausstellte und Urteile verkündete. ˘ Internettipp: www.lorsch.de 4492_1_1_2013_046_081.indd 51 28.02.13 14:57 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
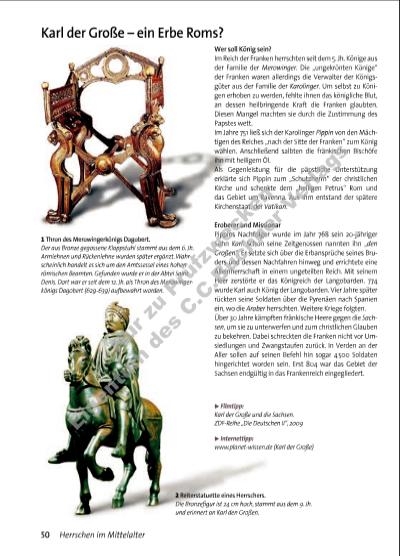 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |