| Volltext anzeigen | |
Ausblick – Mit Material arbeiten 73 1. Prüfe, ob M 1, M 2 und M 4 Quellen oder Darstellungen zum Leben der Elisabeth von Thüringen sind. Begründe deine Aussage. 2. Beurteile die Glaubwürdigkeit von M 1 und M 2. Beachte dabei die Einführungen zu den Texten sowie die Aussage von M 3. 3. Stellt euch vor, ihr müsstet eine Ausstellung zum Leben der Elisabeth von Thüringen gestalten. Welchen Titel würdet ihr wählen? Diskutiert eure Vorschläge. M 4 Das Rosenwunder. Wandgemälde (etwa 158 x 125 cm) von Moritz von Schwind in der Elisabeth-Galerie des Palas der Wartburg, 1855. Das Bild stellt folgende Geschichte dar, die über Elisabeth erzählt wird: Eines Tages, als Elisabeth wieder Lebensmittel an Arme verteilen will, kommt ihr Mann, Landgraf Ludwig von Thüringen, unerwartet dazu. Als er die in der Schürze verborgenen Waren sehen will, haben sie sich in Rosen verwandelt. 5 10 15 5 10 5 10 M 1 Konrad von Marburg berichtet Konrad von Marburg wird 1226 Elisabeths Beichtvater. Ein Jahr nach ihrem Tod fordert er den Papst auf, Elisabeth heiligzusprechen. Dem Oberhaupt der Kirche berichtet er: Als […] sie [Elisabeth] erkannte, dass sie vom Treiben der Welt und vom Glanze jenes Landes, in dem sie zu Lebzeiten ihres Gemahls glanzvoll gelebt hatte, verschlungen werden könnte, folgte sie mir gegen meinen Willen nach Marburg, welches im äußeren Gebiet ihres Mannes lag. Dort in der Stadt erbaute sie ein Hospital und sammelte Kranke und Gebrechliche. Die Bedauernswertesten und am meisten Verachteten setzte sie an ihren Tisch. Als ich sie deswegen tadelte, antwortete sie, sie empfange von ihnen einzigartige Gnade und Demut, und als unzweifelhaft sehr kluge Frau sagte sie, indem sie mir ihr bis dahin gelebtes Leben wieder vortrug, sie habe es nötig, auf diese Art und Weise Gegensätzliches durch Gegensätzliches zu heilen. Sylvia Weigelt (Hrsg.), Elisabeth von Thüringen in den Quellen des 13. bis 16. Jahrhunderts, Erfurt 2007, S. 38 M 2 Schwester Irmingard sagt aus Im Zusammenhang mit dem Heiligsprechungsverfahren sagt um 1235 Schwester Irmingard, eine enge Vertraute Elisabeths, unter Eid aus: [...], dass Elisabeth eine schrecklich aussehende, mit Wunden und Eiter bedeckte Aussätzige im Spital pfl egte, die jeder schon von ferne sich scheute anzusehen, die aber die gottselige Elisabeth aufhob, zudeckte, ihre Wunden mit Tüchern verband und mit Salben behandelte und vor der sie sich niederkniete, um ihre Schuhriemen zu lösen, und der sie auch die Schuhe ausgezogen hätte, wenn sie es zugelassen hätte. Sie schnitt ihr die Nägel an Händen und Füßen und berührte mit der Hand ihr von Geschwüren bedecktes Antlitz. Da wurde sie nach übereinstimmender Aussage auf Lebenszeit geheilt. Sylvia Weigelt (Hrsg.), a. a. O., S. 62 M 3 Unsere Bilder bestimmen den Blick Jürgen Römer, der 2007 das Elisabethjahr organisiert hat, schreibt über die Quellen und Darstellungen: Betrachtet man die Informationen, die zum Leben Elisabeths vorliegen, so stellen sich bei näherem Hinsehen leicht Zweifel ein: All diese Texte, die nach ihrem Tod über sie verfasst werden, wurden im Hinblick auf die Heiligsprechung geschrieben. […] Schon im 13. Jahrhundert wuchern um diese ältesten Berichte neue Legenden und Wundererzählungen. […] Aber nicht nur Texte werden geschrieben, es entstehen Bilder, Glasgemälde, Skulpturen und Fresken, die die bekannten Geschichten auf ihre Weise erzählen, aber auch neue Motive hinzufügen. […] Wenn wir über Elisabeth sprechen, müssen wir uns an vielen Stellen bewusst machen, dass wir über Bilder eines ˘ Lesetipps: • Daria Barow-Vissilevitch, Elisabeth von Thüringen – Heilige, Minnekönigin, Rebellin, Ostfi ldern 2007 • Reinhold Schneider, Elisabeth von Thüringen, Frankfurt am Main 2008 Menschen reden und nicht über den Menschen selbst. Wir müssen darauf achten, was die Menschen zu bestimmten Zeiten an Elisabeth fasziniert hat, wie die verschiedenen Bilder entstanden […]. Jürgen Römer (Hrsg.), Krone, Brot und Rosen – 800 Jahre Elisabeth von Thüringen. Begleitband zur Ausstellung der Evangelischen Kirchen und Diakonischen Werke in Hessen in Kooperation mit dem Hessischen Staatsarchiv Marburg, München – Berlin 2006, S. 11 f. 4492_1_1_2013_046_081.indd 73 28.02.13 14:58 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 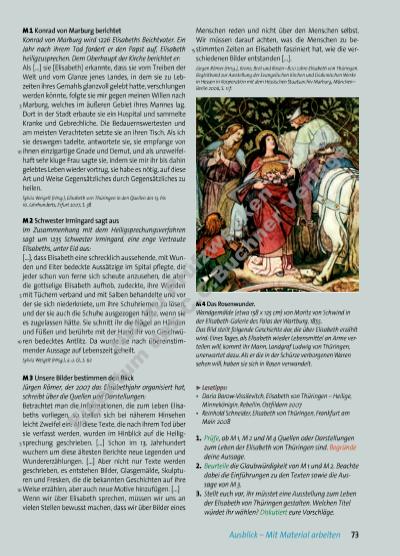 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |