| Volltext anzeigen | |
271 1. Fasst die Gründe zusammen, die für den Kriegsausbruch verantwortlich gemacht wurden (M1, Verfassertext; siehe auch S. 268 f.). 2. Der Historiker Fritz Fischer hat mit seiner These (M1) in Deutschland eine heftige Diskussion ausgelöst. Sammelt die Argumente für bzw. gegen Fischers These und nehmt Stellung zu ihr. 3. Erläutert, inwiefern der Text Q2 damit zu tun hat, dass Krieg auch „in den Köpfen entsteht“. 4. Kaiser Wilhelm II. und der österreichische Kaiser Franz Joseph I. sind Beispiele dafür, wie Monarchen allein über Krieg und Frieden entscheiden durften. Nimm Stellung dazu, welche Folgen eine derartige Machtfülle für die Politik hat. 5. Gestaltet ein Plakat, auf dem ihr Maßnahmen aufl istet, wie die Gefahr von Kriegen vermindert werden kann. M1 Thesen zu den Kriegsursachen Der deutsche Historiker Fritz Fischer schreibt 1977: Da Deutschland den österreichisch-serbischen Krieg gewollt und gedeckt hat und, im Vertrauen auf die deutsche militärische Überlegenheit, es im Juli 1914 bewusst auf einen Konfl ikt mit Russland und Frankreich ankommen ließ, trägt die deutsche Reichsführung den entscheidenden Teil der historischen Verantwortung für den Ausbruch des allgemeinen Krieges. Der deutsche Historiker Peter März schreibt 2008: Entspannung und Spannung, so wird man die heutige historische Forschungslage wohl am treffendsten umschreiben können, bestanden im Europa jener Jahre unmittelbar nebeneinander. Und Rüstung allein musste und muss keineswegs Krieg bedeuten, sie hätte im Gegenteil wohl auch zu Gleichgewichtszuständen führen können, bei den sich die jeweiligen Partner scheuten, zu hohe Risiken einzugehen. Vielmehr kamen zwei Momente hinzu: In beiden Bündnissystem wagten die einzelnen Partner nicht, zu eng mit Akteuren der jeweiligen Gegenseite zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Denn dies konnte möglicherweise die eigenen Verbündeten verunsichern. Wie viele Minuten welcher Souverän1 mit welchem Botschafter sprach, galt als aussagekräftig für weltpolitische Optionen. Was somit vor allem fehlte, waren Vertrauensgrundlagen wie eben in der Zeit der Heiligen Allianz nach dem Wiener Kongress. Erster Text: Fritz Fischer: Griff nach der Weltmacht, Kronberg 1977, S. 82; zweiter Text: Peter März: Der Erste Weltkrieg, Stamsried 22008, S. 45 1 Souverän: hier Staatsoberhaupt sere Klasse unter seiner Führung geschlossen zum Bezirkskommando zog und sich meldete. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er uns durch seine Brillengläser anfunkelte und mit ergriffener Stimme fragte: „Ihr geht doch mit, Kameraden?“ Diese Erzieher haben ihr Gefühl so oft in der Westentasche parat; sie geben es ja auch stundenweise aus. Doch darüber machten wir uns damals noch keine Gedanken. Einer von uns allerdings zögerte und wollte nicht recht mit. Das war Josef Behm, ein dicker, gemütlicher Bursche. Er ließ sich dann aber überreden, er hätte sich auch sonst unmöglich gemacht. Vielleicht dachten noch mehrere so wie er; aber es konnte sich niemand gut ausschließen, denn mit dem Wort „feige“ waren um diese Zeit sogar Eltern rasch bei der Hand. Die Menschen hatten eben alle keine Ahnung von dem, was kam. [...] Es gab ja Tausende von Kantoreks, die alle überzeugt waren, auf eine für sie bequeme Weise das Beste zu tun. Darin liegt aber gerade für uns ihr Bankrott. Sie sollten uns Achtzehnjährigen Vermittler und Führer zur Welt des Erwachsenseins werden, zur Welt der Arbeit, der Pfl icht, der Kultur und des Fortschritts, zur Zukunft. Wir verspotteten sie manchmal und spielten ihnen kleine Streiche, aber im Grunde glaubten wir ihnen. Mit dem Begriff der Autorität, dessen Träger sie waren, verband sich in unseren Gedanken größere Einsicht und menschlicheres Wissen. Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues, Köln 2005, S. 19 f. Q2 Im Westen nichts Neues Der deutsche Dichter Erich Maria Remarque verarbeitet seine Kriegserlebnisse in seinem im November 1928 veröffentlichten Roman „Im Westen nichts Neues“. Er schreibt über die Vorbereitung auf den Krieg durch seine Lehrer: Kantorek war unser Klassenlehrer, ein strenger, kleiner Mann in grauem Schoßrock, mit einem Spitzmausgesicht. [...] Kantorek hielt uns in den Turnstunden so lange Vorträge, bis un5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 35 Lesetipp: Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues, Köln 2008 (Klassiker und Antikriegsroman, der eindringlich die Situation des Stellungskrieges an der Westfront darstellt) N u r zu P rü fz w e c k n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
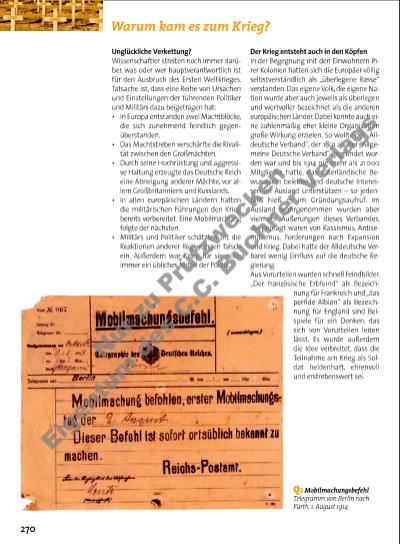 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |