| Volltext anzeigen | |
Die Konsulatsverfassung Napoleon setzte an die Stelle der fünf Direktoren drei Konsuln*. Sich selbst ließ er zum Ersten Konsul ausrufen und seine Stellung vom Volk bestätigen. Von über drei Millionen Stimmen wurden nur 1562 gegen ihn abgegeben. Allerdings beteiligten sich vier Millionen Bürger nicht an der Abstimmung. Die Verfassung, die Napoleon Ende 1799 vorlegte, wahrte den Schein der Gewaltenteilung. Tatsächlich gab sie alle Macht in die Hände des Staatsrats, dessen Vorsitzender Napoleon war. Die Volksversammlung konnte nur über Vorlagen der Regierung abstimmen, sie durfte keine Gesetze vorschlagen oder ändern. Die Abgeordneten wurden zwar vom Volk gewählt, doch waren die Kandidaten vor der Wahl bereits von der Regierung ausgesucht worden. Gegner der Regierungspolitik hatten keine Chance, ins Parlament zu gelangen. Eine gelenkte Presse beeinflusste die zahlreichen Volksabstimmungen, die für den Anschein demokratischer Mitwirkung sorgten. Auch auf die richterliche Gewalt übte Napoleon Einfluss aus: Er selbst setzte alle Richter auf Lebenszeit ein. Diese Regelungen machten aus dem Konsulat die erste Diktatur der Neuzeit. * Konsuln: im alten Rom die jährlich gewählten Leiter der Staatsgeschäfte Maßnahmen zur inneren Befriedung Napoleons Umgestaltung der Verwaltung vollendete, was der Absolutismus seit Ludwig XIV. und die Revoluti onsregierungen vorbereitet hatten. Von Paris aus wurde das Land durch staatlich besoldete, von Napoleon ernannte Berufsbeamte zentral verwaltet. Eine lückenlose Befehlskette half Napoleon, seine Pläne schnell durchzusetzen. Sie führte von der Regierung über die obersten Verwaltungsbeamten der ursprünglich 83 Départements bis zu den Bürgermeistern der Gemeinden. Als Erster Konsul bemühte sich Napoleon um einen Ausgleich zwischen den von der Revolution aufgerissenen Fronten: Er forderte den Adel zur Rückkehr auf, verkündete Religionsfreiheit und sicherte der katholischen Kirche Wiedergutmachung zu. Verordnete Reformen Napoleon formte rasch eine neue Führungsschicht. Zu ihr zählten Angehörige des alten Adels ebenso wie Aufsteiger aus dem Bürgertum. Nicht mehr Geburt und ständische Privilegien entschieden über die Zugehörigkeit, sondern Leistung, Funktion – und die Gunst Napoleons. Ein neues Bildungswesen schuf die Grundlagen für eine Karriere in Staat und Gesellschaft. Um die katastrophale wirtschaftliche Lage zu verbessern, wurde eine neue, im ganzen Land gültige Währung geschaffen. Die Bauern behielten ihre Erwerbungen aus dem ehemaligen adeligen und kirchlichen Besitz. Finanziers, Fabrikanten und Kaufleute profitierten von der freien Wirtschaft und zogen großen Nutzen aus den eroberten Ländern. Der „Code civil“ – ein Fortschritt? Das 1804 veröffentlichte bürgerliche Gesetzbuch, der „Code civil“ (auch „Code Napoléon“ genannt), bildete die rechtliche Grundlage der bürgerlichen Gesellschaftsordnung. Es garantierte einige Errungenschaften der Revolution wie Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit des Einzelnen und des Eigentums sowie Trennung von Staat und Kirche durch die Einführung der Zivilehe. Er bestätigte auch die politische und rechtliche Gleichstellung der Juden. Der „Code civil“ beeinflusste die Rechtsentwicklung in ganz Europa. Die politischen Freiheitsrechte setzte Napoleon jedoch außer Kraft. Ein wertloses Wahlrecht, Presselenkung, eingeschränkte Versammlungsfreiheit, Bespitzelung und politische Morde zeigten das andere Gesicht seiner Herrschaft. 2 Erstausgabe des „Code civil“ von 1804. Dieses Gesetzbuch legte auch die überlieferte rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Frau fest. So bestimmte beispielsweise ein Artikel: „Der Mann ist seiner Frau Schutz, die Frau ihrem Mann Gehorsam schuldig.“ In einem anderen Artikel heißt es: „Die Ehefrau […] kann weder schenken, veräußern, ihr Vermögen zur Hypothek stellen noch erwerben, es sei unentgeltlich oder gegen Ver geltung, sofern nicht ihr Ehemann bei dem Akt selbst mitwirkt oder seine Einwilligung schriftlich gegeben hat.“ 29 Häufig wird behauptet, Napoleons Herrschaft sei eine Diktatur unter dem Mantel der Demokratie gewesen. Was spricht dafür? Was dagegen? Frankreich wird wieder Monarchie Die Reformen entsprachen den Wünschen des reichen Bürgertums. Napoleons Beliebtheit wuchs durch den wirtschaftlichen Aufschwung, der mit seiner Regierungszeit begann. Ende 1804 konn te Napoleon sich selbst zum Kaiser der Franzosen krönen und eine Erbmonarchie einführen. Seine neue Stellung ließ er sich durch einen Volksentscheid von der Bevölkerung bestätigen. 4743_017_032_q7.qxd 12.08.2016 7:52 Uhr Seite 29 Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
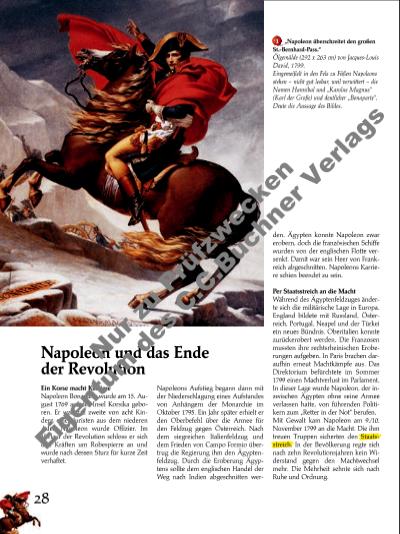 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |