| Volltext anzeigen | |
tierte „ewige Grenze“ des Gebietes der Ureinwohner westlich der Staaten Missouri, Arkansas und Louisiana hielt nur so lange, bis Goldsucher und Siedler auch diese Linie in der zweiten Jahrhunderthälfte in Scharen überschritten und den Verdrängungskampf mithilfe der US-Armee in einen offenen Vernichtungskrieg überführten. In den Prärien des Westens wurde der Hungertod der Ureinwohner systematisch herbeigeführt, indem Jäger den Bison, ihr Hauptnahrungsmittel, so gut wie ausrotteten. Das Massaker von Wounded Knee 1890, bei dem 350 Sioux von Regierungstruppen abgeschlachtet wurden, beendete die Vertreibung und fast vollständige Vernichtung der indigenen Kultur. Von den ursprünglich rund sieben Millionen Ureinwohnern überlebten nur etwa 250 000. Bemühungen, die Überlebenden in den Staatsverband der USA einzugliedern, gab es nicht. Stattdessen wurden sie in Reservate zusammengetrieben und blieben rechtlose Bürger zweiter Klasse. „Big Business“ im „Gilded age“: Aufstieg zur Industrienation Ein enormes Bevölkerungswachstum und ein massiver Industrialisierungsschub ließen die Nation im ausgehenden 19. Jahrhundert zu einer wirtschaftlichen Großmacht werden. Möglich wurde dies durch die reichen Rohstoffvorkommen und den Ausbau des Verkehrsnetzes in einem großen, von Binnenzöllen unbehinderten Wirtschaftsraum. Der Zwang zur Kommunikation in dem riesigen Land sowie die europäische Konkurrenz trugen zu bahnbrechenden Erfi ndungen wie der Schreibmaschine, dem Telefon oder der Rechenmaschine bei. Große Innovationsbereitschaft, enorme Kapitalmengen und der Verzicht der Regierung, die Freiheit der Unternehmer zu beschränken, begünstigten die Entwicklung neuer Produktionsformen (Fließband), Vertriebsarten (Versandhandel, Warenhausketten) und Verkaufsstrategien (Werbung, Markenprodukte). Zwischen 1860 und 1900 steigerte sich das Bruttosozialprodukt um mehr als das Dreifache, die Industrieproduktion erreichte Jahr für Jahr neue Rekorde. Das lockte immer mehr Einwanderer aus Europa und Asien an, die ein unerschöpfl iches Reservoir an jungen und billigen Arbeitskräften bildeten. Um die Jahrhundertwende übernahmen die Vereinigten Staaten in einigen Bereichen wie der Kohleförderung und der Stahlproduktion bereits die Weltführung (u M4). Der „Selfmade-man“, verkörpert durch Industrielle wie Andrew Carnegie (Stahl und Bergbau), John D. Rockefeller (Erdöl) oder Franklin W. Woolworth (Warenhäuser), wurde zum Leitbild. Er stand für einen neuen „Pioniergeist“ und eine wirtschaftsliberale Grundhaltung, deren Überzeugung der Glaube an stetiges Wachstum, einen ungehemmten Wettbewerb und das Recht des Stärkeren war. Der freie Wettbewerb drückte die Preise und verdrängte kleine Firmen. Die großen Unternehmen schlossen sich zu Trusts und Kartellen zusammen, um den Markt zu beherrschen. Dabei schreckten sie nicht vor Bestechung und illegalen Absprachen zurück. John D. Rockefeller bildete 1892 den ersten Trust, der über 90 Prozent der Ölproduktion kontrollierte. Immer größere Kapitalmengen in Aktiengesellschaften und Trusts wurden zum Kennzeichen des „Big Business“. i Blick von der New Yorker Brooklyn Bridge nach Westen auf Manhattan. Foto von 1902. Ein mit dem Wirtschaftswachstum einhergehender Bauboom veränderte das Bild der Städte: Die Wolkenkratzer wurden zum Symbol für das „Big Business“ und die zunehmende Machtstellung der USA in der Welt. Die New Yorker Skyline verbirgt die vielen Elendsviertel der Stadt. Rund 1,5 Millionen New Yorker lebten in düsteren, schmutzigen Mietskasernen in Lower Manhattan. 185Aufstieg zur Weltmacht Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
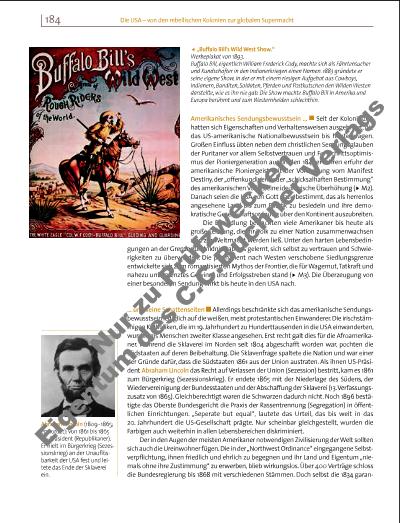 « | 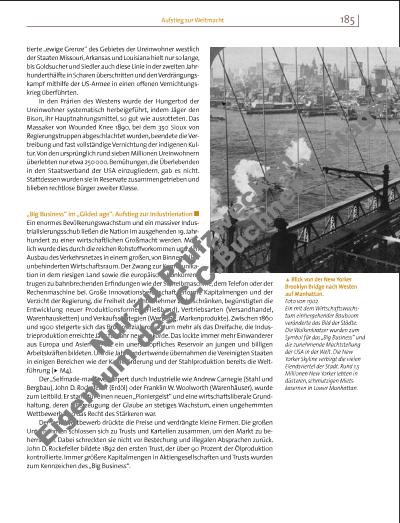 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |