| Volltext anzeigen | |
211 Angegeben sind nur die im Bildungsplan genannten Begriffe. Begriffe Ablass: Nachlass zeitlicher, d.h. befris teter Strafen für Sünden gegen bestimmte Leistungen (Spende, Teilnahme an einer Wallfahrt u.a.m.). Voraussetzung des Ablasses waren aber Reue, Beichte und Freisprechung von den Sünden (Absolution) durch einen Pries ter. Martin Luther (1483-1546) ging gegen den Ablass handel vor, da der → Papst und viele Bischöfe ihn als zusätzliche Einkommensquelle missbrauchten. Absolutismus (lat. absolutus: uneingeschränkt): Herrschaftsform, in der Fürs ten ihre Stellung von Gott ableiteten (Gottesgnadentum) und versuchten, „losgelöst“ von den Gesetzen und den Ständen zu regieren. Die abso lutis tisch regierenden Fürsten fühlten sich nur Gott und ihrem Gewissen verantwortlich. Zu den wichtigsten Machtmitteln der absolutistischen Herrscher gehörte das stehende Heer. Entdeckungen und Eroberungen: Ende des 15. Jh. und im Verlauf des 16. Jh. entdeckten europäische Seefahrer wie Christoph Kolumbus (1451-1506) die Seewege nach Amerika und Indien. Sie schufen damit die Voraussetzungen für die Eroberung Südund Mittel amerikas sowie die Vorherrschaft Europas in der Welt (→ Imperialismus). Erklärung der Menschenund Bürgerrechte: Die französische Nationalversammlung verkündete 1789 Menschenund Bürgerrechte. Sie wurden Bestandteil der Verfassung von 1791. Am Anfang der Entwicklung der Menschenund Bürgerrechte stehen die Magna Charta von 1215 und die Virginia Bill of Rights von 1776. Im engeren Sinne sind Menschen und Bürgerrechte die unantastbaren und unveräußerlichen Freiheiten und Rechte aller Menschen: Recht auf Leben, Unverletzlichkeit der Person, Freiheit und Eigentum. Daraus abgeleitet werden weitere Rechte, die den Einzelnen vor staatlichen Übergriffen schützen sollen: Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubensund Gewissensfreiheit, freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Briefund Postgeheimnis, Schutz des Eigentums und Schutz vor willkürlicher Verhaftung. Fabrikordnungen: Die Arbeit in Fabriken und mit Maschinen erforderte anders als in der Landwirtschaft und im Handwerk feste Arbeitszeiten und geregelte Arbeitsabläufe. In Fabrikordnungen legten die Arbeitgeber die Pflichten der Arbeiternehmer fest und nannten Strafen für Vergehen wie Zuspätkommen, Streit am Arbeitsplatz, Diebstahl, Fahrlässigkeit, Aufruhr usw. Florenz und die Medici: Die ital ie nische Stadt am Arno entwickelte sich im 13. und 14. Jh. zur führenden Macht in Mittelitalien. Fast gleichzeitig verlief der Aufstieg der florentinischen Familie Medici. Sie war durch Handel und Bankgeschäfte zu großem Vermögen gekommen und prägte seit dem 15. Jh. die Politik und Kunst in dem Stadtstaat stark. Unter Lorenzo de Medici (1449-1492) wurde Florenz zum Mittelpunkt der italienischen → Renaissance. Fugger: schwäbisches Geschlecht, das seit 1367 in Augsburg ansässig ist. Durch den Orienthandel, Beteiligungen am Bergbau und Bankgeschäfte (z.B. Kredite für Päpste und Kaiser) wurde die 1494 gegründete Fuggersche Handels-Gesellschaft zu dem bedeutendsten Unternehmen Europas. Die Glanzzeit hatte das Unternehmen unter Jakob II. dem Reichen (1459-1525). Generalstände (frz. États généraux): Seit dem Mittelalter wurden die Vertreter der drei Stände in Krisenzeiten vom König einberufen. Die absolutis tisch regierenden Monarchen hatten seit Anfang des 17. Jh auf die Versammlung verzichtet, in der Adel und Klerus die Mehrheit der Stimmen besaßen. Anfang 1789 rief Ludwig XVI. (17541793; hingerichtet), der seit 1774 regierte, die General stände zur Lösung der Staatskrise ein. Es kam zwischen den Ständen und dem König zum Streit über Stimmrechte. Daraufhin erklärte sich am 20. Juni der Dritte Stand zur Nationalversammlung. Diese Revolution der Abgeordneten bedeutete das Ende der Generalstände und den Anfang der → konstitutionellen Monarchie in Frankreich. Glaubensspaltung: die Aufteilung der mittelalterlichen katholischen Einheitskultur nach der → Reformation bzw. dem „Augsburger Religionsfrieden“ von 1555 in eine Vielzahl von Konfessionen und Kirchen (Katholiken, Lutheraner, Zwinglianer, Calvinisten, Anglikaner und Hugenotten). Zu den Folgen der Glaubensspaltung zählen die Glaubenskriege: Je stärker die Konfessionen und ihre Abgrenzung alle Lebensbereiche bestimmten, um so mehr wurden aus zunächst religiös motivierten Konflikten politische Auseinandersetzungen. Ein Beispiel dafür ist der Dreißigjährige Krieg, der mit dem → Westfälischen Frieden 1648 endete. Damit war das Zeitalter der Glaubenskriege vorbei, aber nicht die Glaubensspaltung. Hanse: zunächst eine Gemeinschaft (Hanse) von Kaufleuten im Ostund Nordseeraum. Unter Führung Lübecks entstand um die Mitte des 13. Jh. ein Bund von freien Hansestädten, der bis zum 15. Jh. im Ostseeraum den Handel beherrschte und die stärkste politische Macht war. Imperialismus (lat. imperium: Herrschaft): „Großreichspolitik“ in allen Epochen. Im engeren Sinne die direkte oder indirekte Herrschaft wirtschaftlichindustriell entwickelter Mächte Europas, der USA und Japans über unterlegene Regionen, die zu Kolonien (lat. colonia: Ansiedlung auf eroberten Gebieten) gemacht wurden. Die → Entdeckungen und Eroberungen, die → Industrielle Revolution und → der → Nationalismus beeinflussten diese Politik, die im Ersten Weltkrieg (19141918) endete. 4753_206_224 03.11.16 07:57 Seite 211 N r z u Pr üf zw ec ke n E e t m s C .C .B uc hn r V er la gs | |
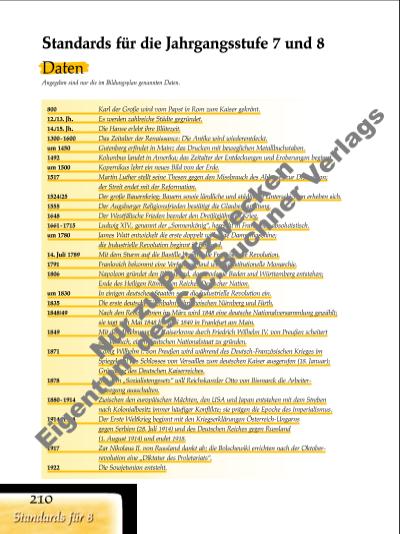 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |