| Volltext anzeigen | |
215Deutschland und die geteilte Welt nach 1945 Volksaufstand Nachdem Stalin am 5. März 1953 gestorben war, erwarteten viele Menschen in der DDR eine Verbesserung der Lage. Doch die Hoffnungen sanken, als die Verantwortlichen im Mai 1953 die Arbeitsnormen in den „Volkseigenen Betrieben“ um zehn Prozent erhöhten. Bei gleichem Lohn sollte also mehr gearbeitet werden. Daraufhin kam es zu Unruhen unter den Arbeitern. Die neue sowjetische Parteispitze befürchtete den wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch der DDR und befahl einen Kurswechsel: Die SED sollte den „Aufbau des Sozialismus“ langsamer und unter Rücksichtnahme auf die Bevölkerung betreiben. Obwohl die Parteiund Staatsführung die Arbeitsnormerhöhung kurzfristig zurücknahm, legten Berliner Bauarbeiter am 16. Juni ihre Arbeit auf den Baustellen in der Stalinallee nieder. Aus dem Streik entwickelte sich ein Volksaufstand. Am 17. Juni und den folgenden Tagen demonstrierten und streikten die Menschen im gesamten Land. Sie forderten „Nieder mit der SED“, „Freie Wahlen“, „Freilassung aller politischen Häftlinge“, „Rücktritt der Regierung“, „Abzug der Besatzungstruppen aus Deutschland“ und „Wiedervereinigung“. Am frühen Nachmittag des 17. Juni war die Parteiund Staatsführung praktisch machtlos, obwohl sie die Arbeitsnorm erhöhung zurückgenommen hatte. Die in der DDR stationierten sowjetischen Soldaten sicherten der SED die Herrschaft. Die Sowjets verhängten in 167 von 217 Stadtund Landkreisen den Ausnahmezustand. Es galt das Kriegsrecht. Panzer fuhren auf und öffentliche Versamm lungen wurden verboten. Unterstützt von Volkspolizei und Staatssicherheitsdienst schlugen die sowjetischen Soldaten den Aufstand nieder. Die Bilanz des Aufstandes Zwischen dem 16. und 21. Juni 1953 beteiligten sich rund eine Million Menschen in mehr als 700 Orten an Streiks, De mon s trationen oder Kundgebungen. In über 1 000 Betrieben und Genossenschaften ruhte die Arbeit. Aus zwölf Haftanstalten wurden etwa 1 500 Häftlinge befreit. Bei den Unruhen kamen zwischen 40 und 50 Menschen ums Leben. Etwa 15 000 Personen wurden festgenommen, darunter 226 aus West-Berlin und zwei aus Westdeutschland. Bis Ende Januar 1954 wurden über 1 500 Demonstranten verurteilt, davon zwei zum Tode.* Die SED machte für den Aufstand „westliche Kriegstreiber“ verantwortlich. Dagegen protestierte die Bundesregierung. Sie und die Westmächte hatten sich während des Aufstandes zu rück gehalten, weil sie einen Krieg vermeiden wollten. Nur wenige Wochen nach dem Ereignis erklärten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf Anregung der SPD den 17. Juni zum Tag der deutschen Einheit. Bis 1990 hielt man an dem Gedenktag fest. Gehen oder bleiben? Nach dem 17. Juni 1953 lockerte die SED-Führung den politischen Druck nicht, versuchte aber, die Bevölkerung durch ein besseres Angebot an Konsumgütern zum Bleiben zu bewegen. Dar über hinaus sollte sich die wirtschaftliche Lage durch den Verzicht der Sowjetunion auf weitere Repa rations leistungen verbessern. Tatsächlich stieg langsam der Lebensstandard. 1958 wurden die Lebens mittel karten abgeschafft und die Rationierung für Fleisch, Fett und Zucker wurde aufgehoben. Doch die fortgesetzte Kollektivierung und Verstaatlichung trug zu wirtschaftlichen Rückschlägen und Versorgungsengpässen bei. Immer mehr Menschen – vor allem junge und gut ausgebildete Frauen und Männer – kehrten der DDR den Rücken und gingen in den Westen. Der 17. Juni 1953 1 Steine gegen sowjetische Panzer. Foto von Wolfgang Albrecht vom 17. Juni 1953. Ort: Ost-Berlin, Leipziger Straße/Pots damer Platz; links im Hintergrund die Ruine des Kaufhauses Wertheim, rechts das Gebäude des Preußischen Landtages (heute: Sitz des Bundesrates). ó Von dem Foto werden oft nur Ausschnitt ver größe rungen (siehe Unter legungen) veröf fent licht. Beschreibe, wie sie die Wirkung des Bildes verändern. * Die DDR schaffte die Todesstrafe erst im Juli 1987 ab. ˘ Geschichte In Clips: Zum „Volksaufstand“ siehe Clip-Code 31013-11 ˘ Internettipp: Informationen und Materialien zum 17. Juni 1953 siehe unter Mediencode 31013-63 ˘ Lesetipp: Erich Loest, Sommergewitter, Göttingen 2005 ˘ CD-ROM-Tipp: 17. Juni 1953. Zeit zeugen berichten, Köln: DeutschlandRadio 2003 31013_1_1_2015_164_227_kap4.indd 215 26.03.15 15:31 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um de s C .C . B uc hn er V er la gs | |
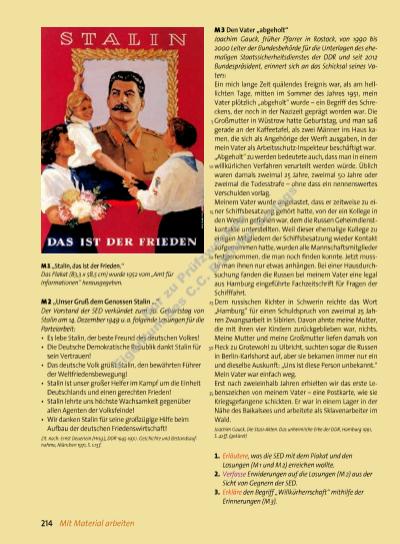 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |