| Volltext anzeigen | |
160 „Volk“ und „Nation“ im Deutschen Kaiserreich Auf dem Weg zum Nationalstaat – die Reichsgründung von 1871 Restauration Österreich übernahm im wiederhergestellten Deutschen Bund 1850 wieder die Führungsrolle und lehnte den Wunsch Preußens nach einem regelmäßigen Wechsel im Vorsitz der Bundesversammlung ab. Einigkeit herrschte zwischen den beiden Großmächten vor allem beim Kampf gegen das Erbe der Revolution. Eine repressive Gesetzgebung behinderte die Bildung und Betätigung politischer Parteien sowie die Pressefreiheit. Auf gemeinsamen Antrag hin wurden die von der Paulskirche erarbeiteten und beschlossenen Grundrechte noch 1851 aufgehoben. Ein „Reaktionsausschuss“ des Deutschen Bundes überwachte die Rücknahme fortschrittlicher Verfassungsbestimmungen in den Einzelstaaten. Österreich setzte seine Verfassung außer Kraft und hielt bis 1867 am Neoabsolutismus fest. Die preußische Verfassung wurde zugunsten der monarchischen Gewalt geändert: Die Regierung war allein vom Vertrauen des Monarchen abhängig, das Militär war jeglicher Kontrolle durch Parlament und Regierung entzogen. Heeresund Verfassungskonfl ikt Dennoch herrschte nicht völlige politische Stille, auch nicht in Preußen. Die Auseinandersetzung zwischen Liberalen und Obrigkeitsstaat entzündete sich am Verfassungskonfl ikt um die Heeresreform. Wilhelm I., seit 1861 preußischer König, stimmte mit den Adligen im Herrenhaus und der liberalen Mehrheit im Abgeordnetenhaus zwar darin überein, zur Wiederherstellung des Kräftegleichgewichts zwischen Preußen und den anderen Großmächten die Friedensstärke der Armee von 150 000 auf 210 000 Mann zu erhöhen. Jedoch stießen die Pläne des Königs und des Kriegsministers Albrecht von Roon auf Widerstand. Sie wollten die Dienstzeit von zwei auf drei Jahre verlängern sowie drei Jahrgänge der von bürgerlichen Reserveoffi zieren geführten Landwehr dem Kommando adliger Berufsoffi ziere unterstellen und diese zu einer Reservearmee machen. Die liberalen Abgeordneten erkannten die antibürgerliche Stoßrichtung und befürchteten eine Militarisierung der Gesellschaft. Der Streit weitete sich zum Verfassungskonfl ikt aus, als das – wiederholt aufgelöste – Abgeordnetenhaus auf sein Budgetrecht pochte und erstmals eine genaue Aufl istung der einzelnen Etatposten verlangte. Damit hätte sich die Möglichkeit ergeben, einzelne Positionen abzulehnen. Bisher waren die Militärhaushalte immer pauschal vorgelegt worden. In der sich über Jahre hinziehenden Auseinandersetzung ging es letztlich um die Forderung der Volksvertretung nach einem Mitspracherecht auch in Militärangelegenheiten, während sich der König auf seine Kommandogewalt berief und daraus das Recht ableitete, allein zu entscheiden. Entscheidung in Hoffnung auf den Nationalstaat Im Kampf für die verfassungsmäßigen Rechte der Volksvertretung hatte sich 1861 in Preußen aus Liberalen, die eine nachgiebige Haltung gegenüber Monarch und Regierung ablehnten, aus Linksliberalen und Demokraten die Deutsche Fortschrittspartei gebildet. Bereits ein Jahr später stellte sie die stärkste Fraktion. Otto von Bismarck*, der 1862 preußischer Ministerpräsident wurde, beharrte auf der alleinigen Entscheidungsbefugnis bei der Heeresreform und Filmtipp: Deutschland auf dem Weg zum Nationalstaat 1815 1871. Ein Film von Carola Haffmann und Anne Roerkohl, 2010 Wilhelm I. (1797 1888): preußischer König (1861 1888) und Deutscher Kaiser ab 1871 Albrecht Graf von Roon (1803 1879): preußischer Generalfeldmarschall, Kriegsminister (1859 1871) Landwehr: Bestandteil des preußischen Heeres. Sie umfasste alle Männer bis zum 40. Lebensjahr, die nicht dem stehenden Heer angehörten. * Zu Otto von Bismarck siehe S. 29. Neoabsolutismus: Regierungsform ohne Verfassung und Parlament, die sich am Aufgeklärten Absolutismus des 18. Jh. orientiert und liberale Bestrebungen des Bürgertums sowie Anliegen nationaler Minderheiten unterdrückt. 4677_1_1_2015_158-183_Kap5.indd 160 17.07.15 12:26 Nu zu P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d es C. C. Bu ch ne r V er la gs | |
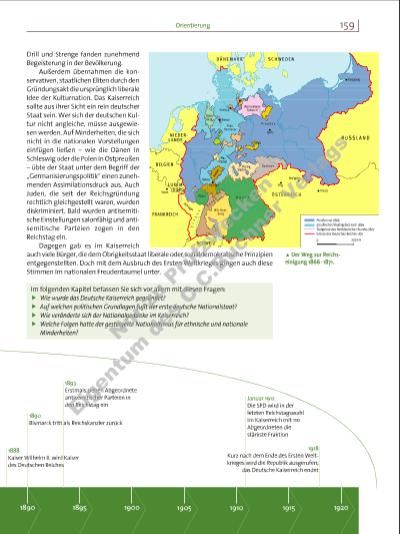 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |