| Volltext anzeigen | |
Geschichte kontrovers Geschichte kontrovers 180 Gibt es einen „deutschen Sonderweg“? Das national eingestellte Bürgertum des Deutschen Kaiserreiches war von der Überlegenheit seiner Kultur gegenüber den liberaleren Staaten des „Westens“ fest überzeugt. Es verurteilte die „Ideen von 1789“ und lehnte Verfassungen des „Erbfeindes“ Frankreich ebenso ab wie die der Vereinigten Staaten von Amerika. Noch während des „Dritten Reiches“ und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg stellten erstmals emigrierte deutsche Historiker und Sozialwissenschaftler die Frage, wie der Nationalsozialismus möglich war. In dem Zusammenhang machten sie auf die besondere Entwicklung der deutschen Nation im Vergleich zu anderen Staaten aufmerksam. Daraus entwickelte sich eine Kontroverse, die ihren Höhepunkt in den 1980er-Jahren erreichte. M1 „Sonderwege“ oder „Normalwege“? Horst Möller vom Institut für Zeitgeschichte gibt im November 1981 auf einer Tagung Folgendes zu bedenken: Grundsätzlich ist festzustellen: Die Diskussion über den „deutschen Sonderweg“ ist immer geprägt worden durch fundamentale Erschütterungen, seien es nun Revolutionen oder Kriege. Und diese Erschütterungen haben jeweils zu spezifi schen Wertungen mit politischer Pointe geführt. Solche auslösenden Erschütterungen waren die Revolutionen von 1848/49, der Erste Weltkrieg, die Revolution von 1918/19, die NS-Machtergreifung 1933 und auch das Kriegsende 1945. Ein Blick auf die Sonderwegsvorstellungen nach diesen Daten lässt jedes Mal eine Veränderung in der Bewertung erkennen. [...] Die Rede vom deutschen Sonderweg impliziert zweierlei: Einmal impliziert sie die Annahme, dass es in der Geschichte Normalwege gibt, und zweitens impliziert sie – zumindest der Intention nach – einen Vergleich, denn sonst könnte man nicht sinnvoll vom Sonderweg sprechen. Hört der Historiker den Begriff Sonderweg einer Nation, dann antwortet er normalerweise: In der Geschichte gibt es, streng genommen, nur Sonderwege. Insofern ist es nichts Besonderes, vom „deutschen Sonderweg“ zu sprechen: Jeder europäische Staat – und natürlich auch die außereuropäischen Staaten – hat gewissermaßen einen Sonderweg in die Moderne beschritten. Gerade eine tiefere historische Betrachtung demonstriert schnell: Die Prämisse eines Normalwegs ist nicht verifi zierbar und außerordentlich fragwürdig. Dies umso mehr, als sie meist eine Idealisierung des vermeintlichen Normalwegs impliziert. So etwa die Annahme, England – der Staat, in dem die moderne parlamentarische Demokratie am frühesten verwirklicht worden ist – habe den historischen Normalweg beschritten. Nun stellen die Historiker immer wieder fest: Gerade die historische Entwicklung Englands kann – verglichen mit der anderer europäischer Staaten – als Sonderweg par excellence gelten. Auch erweist sich jede Idealisierung schnell als unbegründet, wenn man sich die englische „Demokratie“ des 19. Jahrhunderts vorurteilsfreier ansieht: Bis zu den letzten Wahlrechtsreformen der Achtziger Jahre war England keineswegs eine moderne Demokratie.1 Man kann sogar sagen, das Wahlrecht des Deutschen Kaiserreichs von 1871 war während des ersten Jahrzehnts moderner als das englische. […] Schließlich: Es muss bei einem komparatistischen2 Vorgehen dieser Art begründet werden, warum England und Frankreich, und nicht auch andere Staaten – beispielsweise: Spanien, Italien oder auch osteuropäische Länder – die Vergleichskriterien liefern. Ausschließliche politische Orientierung des Vergleichs an der heutigen Demokratie mittelund westeuropäischen Zuschnitts ist zwar politisch begründbar, aber geschichtswissenschaftlich fragwürdig. Mit diesem Plädoyer für den Vergleich und der Forderung nach kritischer Refl exion über die historische Kategorie eines deutschen Sonderwegs soll nicht die Berechtigung dieser Fragestellung bestritten werden, soll keineswegs einer unangemessenen Beruhigung gegenüber der Problematik der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts das Wort geredet werden. Die Frage ist unabweisbar: Warum kam es unter den westund mitteleuropäischen Staaten einzig in Deutschland zu einer Diktatur von solch singulärer Radikalität? Horst Möller, in: Deutscher Sonderweg – Mythos oder Realität? Ein Colloquium im Institut für Zeitgeschichte, München 1982, S. 10 12 (gekürzt) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1 Das Wahlrecht war in England bis 1884 an Hausund Grundbesitz gebunden, erst danach durften auch Mieter und Untermieter wählen. Bis zur Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 1918 blieb über ein Drittel der erwachsenen Männer von Wahlen ausgeschlossen. 2 komparatistisch: vergleichend 4677_1_1_2015_158-183_Kap5.indd 180 17.07.15 12:26 Nu r z u Pr üf zw ec ke Ei ge nt um d e C .C .B uc hn V er la gs | |
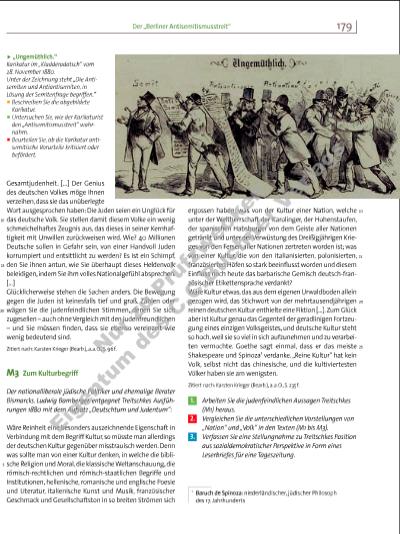 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |