| Volltext anzeigen | |
230 Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa Ausgrenzung und Verfolgung Der Rechtsstaat wird ausgehöhlt Mit der Verordnung des Reichspräsidenten „Zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 war die erste Schranke des Rechtsstaates gefallen. Die Polizei konnte nun ohne Angabe des Grundes Personen bespitzeln oder verhaften, durfte sie ohne Verhör durch einen Richter festsetzen, konnte Wohnungen durchsuchen, Eigentum beschlagnahmen, Zeitungen zensieren und verbieten, Telefone überwachen, Parteien und Vereine aufl ösen. Die Schaffung neuer Straftatbestände, so z. B. die Kritik an der Regierung, das Verbreiten ausländischer Nachrichten oder ganz generell der Verstoß gegen das „gesunde Volksempfi nden“, öffnete willkürlichen Urteilen Tür und Tor. Für Delikte wie Hochverrat legten die neuen Machthaber rückwirkend die Todesstrafe fest. Waren zwischen 1907 und 1932 in Deutschland 1 400 Menschen zum Tode verurteilt und 345 hingerichtet worden, so sprachen die Strafgerichte unter nationalsozialistischer Herrschaft zwischen 1933 und 1944 13 405 Todesurteile aus, von denen 11 881 vollstreckt wurden. Polizei und Justiz Im Rahmen der „Gleichschaltung“ übernahmen die Nationalsozialisten in den Ländern die Polizeigewalt. Neben den regulären Polizeiapparat stellten sie eine Hilfspolizei. Deren Truppen bestanden überwiegend aus Männern der Sturmabteilung (SA) und der Schutzstaffel (SS). Den paramilitärischen Verbänden der nationalsozialistischen „Kampfzeit“ wurden damit hoheitliche Polizeibefugnisse zugestanden. Die Folgen erlebte man anlässlich des „Röhm-Putsches“ am 30. Juni 1934, als Hitler Meinungsverschiedenheiten mit dem SA-Führer Ernst Röhm zum Anlass nahm, gemeinsam mit Reichswehr und SS politische Gegner zu beseitigen. Das „Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr“ vom 3. Juli 1934 sollte die Vorgänge nachträglich rechtfertigen. 1936 erging das Verbot, Maßnahmen der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Gestapo verfolgte politische Gegner des NS-Staates. Ähnliche Aufgaben hatte der Sicherheitsdienst (SD). Bei all diesen Vorgängen gab es kaum Proteste oder Rücktritte, denn viele Richter und Staatsanwälte waren eingeschüchtert, da das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums die Möglichkeit geschaffen hatte, missliebige Beamte aus dem Dienst zu entfernen. Seit der „Machtergreifung“ liefen sie ohnehin Gefahr, dass ihre Urteile von den Nationalsozialisten „korrigiert“ wurden (u M1). Ergingen Freisprüche oder fi elen die Strafen nach Meinung der Machthaber zu milde aus, nahm nicht selten die Gestapo die Angeklagten in „Schutzhaft“. Um die Betroffenen davor zu bewahren, verhängten die Gerichte oftmals härtere Urteile, die dann im Rahmen des staatlichen Justizvollzugs vollstreckt wurden. Umgekehrt verschoben die Justizbehörden Verfahren gegen Mitglieder der SA und SS bis zur nächsten Amnestie. Am Volksgerichtshof, seit 1936 als ordentliches Gericht für Hochund Landesverrat zuständig, waren die Rechte der Angeklagten beschränkt, das Urteil stand in aller Regel im Vorhinein fest. Dort wurden bis 1945 rund 5 200 Todesurteile gefällt. Die meisten dieser Todesurteile gehen auf das Konto Roland Freislers, der seit 1942 den Vorsitz des Volksgerichtshofes führte und wegen seiner fanatischen und demütigenden „Schauprozesse“ als berüchtigtster Strafrichter der NS-Zeit gilt. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Freisler im Februar 1945 gerade auf dem Weg ins Gericht war, als er starb: Ein Luftangriff auf Berlin setzte seinem Leben ein Ende. Ernst Röhm (1887 1934): früher Förderer und Freund Adolf Hitlers; ab 1930 mit der Reorganisation der SA betraut; als Stabschef der SA einer der mächtigsten Männer der NS-Bewegung; wollte aus der SA ein Volksheer machen, in dem die Reichswehr aufgehen sollte, was Hitlers Plänen entgegenstand; im Juni 1934 gemeinsam mit ca. 100 weiteren SA-Führern und Regime gegnern ermordet Sicherheitsdienst (SD): 1931 als Geheimdienst der SS zur Überwachung politischer Gegner und Parteimitglieder eingerichtet, ab 1934 parteiinterner Nachrichtendienst der NSDAP Internettipp: Ende Januar 2013 hat der Bayerische Rundfunk eine „Dokumentarische Höredition“ mit dem Titel „Die Quellen sprechen“ gestartet. In 16 Folgen werden mehrere Hundert Briefe, Tagebucheinträge, Verordnungen und Befehle des NS-Regimes, aber auch Zeitungsberichte und andere Quellen vorgetragen, die die Verfolgung, Entrechtung und Ermordung der europäischen Juden zwischen 1933 und 1945 spiegeln. Siehe Code 4677-19. 4677_1_1_2015_218-275_Kap7.indd 230 17.07.15 12:07 Nu r z u Pr üf z ec ke n Ei ge tu m d s C .C .B uc h r V er la gs | |
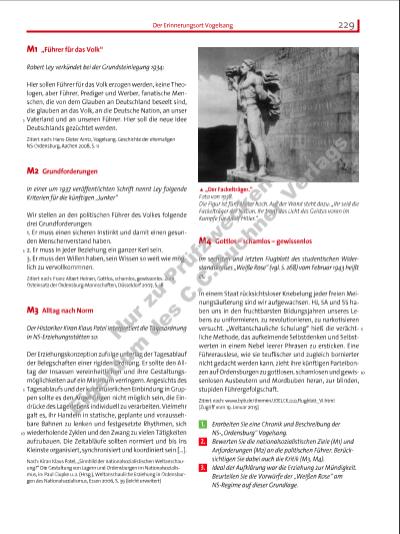 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |