| Volltext anzeigen | |
Karl Marx (1818 1883): protestantisch getaufter Jude aus Trier; Ökonom, Philosoph und Begründer des Marxismus Friedrich Engels (1820 1895): Kaufmann, Philosoph und sozialistischer Politiker aus Barmen, Freund und Mit arbeiter von Marx 28 Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft Ansätze zur Lösung der Sozialen Frage Die Entstehung der Sozialen Frage Das 19. Jahrhundert war geprägt von einem hohen Bevölkerungswachstum. Für die Industriearbeiter und die Lohnarbeiter in der Landwirtschaft, die nichts als ihre Arbeitskraft hatten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, wurde zeitgenössisch der Begriff Proletarier üblich. Deren Lebenserwartung war wegen der schwierigen Arbeitsund Lebensbedingungen gering. Zwischen 1882 und 1907 verdoppelte sich die Arbeiterschaft in Deutschland, bis zum Ersten Weltkrieg wurde sie zur größten sozialen Gruppe. Immer mehr Menschen zogen in die Industriegebiete und waren in Großunternehmen tätig. Trotz ihres wachsenden Anteils an der Bevölkerung blieben die Arbeiter lange ohne politische Mitbestimmung. Die Wahlsysteme bevorzugten häufi g Bürger mit großem Vermögen, so etwa das Dreiklassenwahlrecht in Preußen, das die unteren Schichten nahezu zur politischen Bedeutungslosigkeit verurteilte. Bereits die Zeitgenossen sahen die Not und die daraus erwachsenden sozialen Probleme. Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen unabhängig voneinander die ersten Genossenschaften, die Hilfe zur Selbsthilfe boten. Vorschussund Kreditvereine – die Vorläufer der heutigen Volksbanken – sollten den Mitgliedern Kredite für nötige Investitionen gewähren. Einzelne Unternehmer versuchen zu helfen Die Mehrzahl der Unternehmer sah in den Arbeitern in erster Linie einen Kostenfaktor und kümmerte sich nicht um deren Lebensbedingungen. Nur wenige Arbeitgeber entschieden sich, die Lage ihrer Beschäftigten zu verbessern. Dabei spielten nicht nur christliche und allgemein humanitäre Überlegungen eine Rolle, sondern auch die Furcht, die zunehmende Verelendung der Arbeiter könnte zu Aufständen oder zur Revolution führen. Daher gründeten etwa die Großunternehmer Alfred Krupp (u M2) und Friedrich Harkort in ihren Betrieben ab 1836 erste Betriebskrankenkassen. Dies sicherte die Familien der Arbeitnehmer ab, wenn der Ernährer krank wurde oder wegen Invalidität nicht mehr oder nur eingeschränkt arbeiten konnte. Ergänzt wurde diese Absicherung im Krankheitsfall durch eine Altersversorgung, zu deren Finanzierung die Unternehmer beitrugen. Der Bau von Werkswohnungen sollte die Wohnsituation der Beschäftigten verbessern. Hygieneund Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz dienten der Vorbeugung von Krankheiten und Unfällen. Durch den Einkauf von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs in Konsumvereinen konnten die Arbeiter ihre Lebenshaltungskosten senken. Der revolutionäre Weg: Karl Marx und der Kommunismus Unter dem Eindruck der katastrophalen Lebensumstände der Arbeiterschaft entwickelte der Philosoph und Journalist Karl Marx in Zusammenarbeit mit dem Unternehmersohn Friedrich Engels die Theorie des modernen Kommunismus. Im Zentrum von Marx’ Weltbild stand der Gedanke, dass die Wirtschaft das zentrale Element jeder Gesellschaft sei (Materialismus). Veränderungen in einer Gesellschaft können demnach nur durch die Änderung der materiellen Verhältnisse erreicht werden. Marx unterteilte die Geschichte der Menschheit bis in die Gegenwart in vier Zeitabschnitte: Urgesellschaft, antike Sklavenhaltergesellschaft, mittelalterliche Feudalgesellschaft und die Epoche des Kapitalismus, der auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln beruhe. Seiner Ansicht nach war das soziale Elend der Arbeiter eine zwangsläufi ge Folge der Produktionsbedingungen des Kapitalismus, da sich in dieser Gesellschaftsordnung zwei Klassen Proletarier: Der Begriff leitet sich ab von der Bezeichnung für diejenigen Bürger im Alten Rom, die nichts anderes besaßen als ihre eigenen Nachkommen (lat. proles). Dreiklassenwahlrecht: Wahlsystem, bei dem die wenigen Großsteuerzahler der ersten Klasse (etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten) ebenso viele Abgeordnete wählen konnten wie die Masse der Bevölkerung (rund 80 Prozent). Dieses Wahlsystem galt in Preußen von 1850 bis 1918. Genossenschaft: Zusammenschluss von selbstständigen Personen zu einem Geschäftsbetrieb. Damit können verschiedene Bereiche wie Einkauf, Lagerung oder Maschinenhaltung gemeinsam („genossenschaftlich“) betrieben und die Kosten verteilt werden. 4677_1_1_2015_010-047_Kap1.indd 28 17.07.15 11:36 Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er er la gs | |
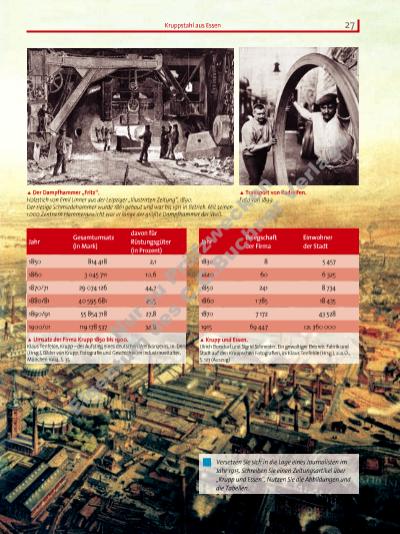 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |