| Volltext anzeigen | |
30 Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft Die Gewerkschaften Koalitionsverbote, die den Zusammenschluss von Arbeitern untersagten, sowie das Verbot von Streiks behinderten zunächst die Entstehung von Gewerkschaften nach englischem Vorbild. Erst seit den Sechzigerjahren konnten sich die Arbeitervereinigungen wirksam für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzen. Jetzt wurde eine Vielzahl von Gewerkschaften gegründet, die sich teils eng an die Arbeiterparteien anlehnten. 1877 hatten die den Sozialdemokraten nahe stehenden Freien Gewerkschaften rund 52 000 Mitglieder. Die nach Aufhebung des „Sozialistengesetzes“ als Dachorganisation aller Einzelgewerkschaften gegründete „Generalkommission der Freien Gewerkschaften“ führte ab 1899 eine ganze Reihe großer Streiks durch, womit die Gewerkschaften bessere Arbeitsbedingungen erreichten. Die Mitgliederzahl der Freien Gewerkschaften erhöhte sich von rund 294 000 (1890) auf über 2,5 Millionen (1913). Neben den sozialdemokratisch ausgerichteten Gewerkschaften entstanden 1868 auch bürgerliche Gewerkschaften unter der Führung von Max Hirsch und Franz Duncker, die Hirsch-Duncker’schen Gewerkvereine. Schließlich gab es mehrere Christliche Gewerkschaften, die sich erst 1901 zum „Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands“ zusammenschlossen. Gemessen an den Mitgliederzahlen und in ihrer Bedeutung blieben die bürger lichen und christlichen Gewerkschaften aber weit hinter den Freien Gewerkschaften zurück. Die bürgerliche Frauenbewegung In den deutschen Staaten hatten sich auch Frauen bereits im Vormärz und noch mehr während der Revolution von 1848/49 in Vereinen zusammengeschlossen. So organisiert, drängten sie auf gesellschaftliche Veränderungen und erhofften sich politische Freiheit. Wichtige Impulse für den Kampf um die Rechte der Frau waren dabei von der Aufklärung und der Französischen Revolution ausgegangen. Vor allem aber hatte der gesellschaftliche Wandel infolge der Industrialisierung nicht nur die Soziale Frage, sondern zugleich auch die „Frauenfrage“ aufgeworfen. Da das Preußische Vereinsgesetz von 1850 den Frauen die Mitgliedschaft in politischen Vereinigungen sowie die Teilnahme an politischen Veranstaltungen verbot, konzentrierten sich die Vereine in den 1860er-Jahren auf die Mädchenbildung und auf die Berufschancen unverheirateter Frauen. Bürgerliche Frauen engagierten sich für die Verbesserung der sozialen und ökonomischen Lage der Arbeiterinnen und Arbeiterfrauen. Erste Kinderschutzvereine wurden gegründet, in deutschen Großstädten errichtete man Entbindungsheime und „Kinderbewahranstalten“. Volksküchen wurden eröffnet, um berufstätige Frauen zu entlasten und sie mit gesunder Ernährung bekannt zu machen. Die Frauen erteilten Mädchen aus den Unterschichten Hauswirtschaftsunterricht, kümmerten sich um Not leidende Arbeiterfamilien, um Prostituierte und die Reintegration weiblicher Strafgefangener. 1865 wurde auf Initiative von Louise Otto-Peters, der Vorsitzenden des Leipziger Frauenbildungsvereins, der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF) gegründet. Er gilt als Ausgangspunkt der organisierten deutschen Frauenbewegung. Ziel des ADF war es, „alle der weiblichen Arbeit im Wege stehenden Hindernisse“ zu beseitigen. Langfristig sollten bessere Bildung und die Öffnung qualifi zierter Berufe für Frauen die Voraussetzungen für politische Mitsprache sein. Louise Otto-Peters (1819 1895): Schriftstellerin und Journalistin; gründete 1849 die erste deutsche „FrauenZeitung“ und engagierte sich seit den 1860er-Jahren in der bürgerlichen Frauenbewegung i Polizeieinsatz gegen streikende Bergarbeiter im Ruhrgebiet. Foto vom März 1912. Am 11. März 1912 legten rund 170 000 Bergleute im Ruhrgebiet die Arbeit nieder, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Es war der erste geplante Streik in der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Er scheiterte jedoch: Angesichts des eingesetzten Militärs, vor allem aber wegen der mangelnden Solidarität und des Streits zwischen den konkurrierenden Richtungsgewerkschaften gaben die Bergleute nach einer Woche auf. 4677_1_1_2015_010-047_Kap1.indd 30 17.07.15 11:36 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn r V er la gs | |
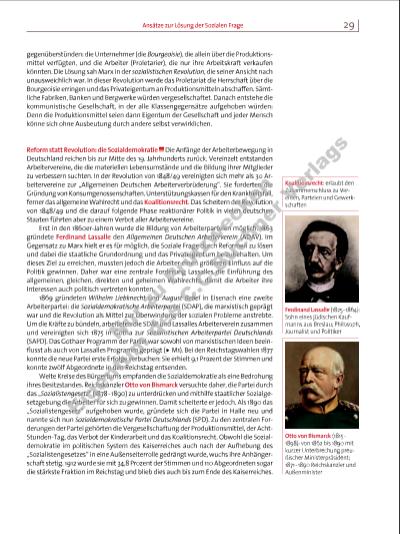 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |