| Volltext anzeigen | |
Reformen: Modernisierung zwischen Pragmatismus und Zwang Napoleon ordnete seine Herrschaftsbereiche neu. Seinem Schwager Joachim Murat vertraute er das linksrheinische Großherzogtum Berg an. Es sollte für immer bei Frankreich bleiben. Das neu entstandene Königreich Westfalen machte er zum Modell für die Rheinbundstaaten. Es wurde von Napoleons jüngstem Bruder Jérôme Bonaparte regiert und bekam Ende 1807 eine Verfassung nach französischem Vorbild. Alle Rheinbundstaaten wurden umfassend modernisiert. Sie erhielten einheitliche Wirtschaftsgebiete, zentrale Verwaltungen und neue Rechtsordnungen nach dem Vorbild des „Code civil“. Unter ganz anderen Voraussetzungen wurde das Königreich Preußen reformiert. Riesige Gebietsverluste, erdrückende Abgaben an Frankreich und der Wunsch, bald wieder zum Kreis der Großmächte zu gehören, zwangen die Regierung zu einer Mobilisierung aller Kräfte. Der leitende Minister Karl Freiherr vom und zum Stein sowie sein Nachfolger, Karl August Freiherr von Hardenberg, setzten sich für einen effi zienteren Staat, den Abbau ständischer Privilegien und die Selbstverantwortung der Bürger ein. Eingeleitet wurden die preußischen Reformen 1807 durch das Oktoberedikt. Es sollte alles beseitigen, „was den Einzelnen bisher hinderte, den Wohlstand zu erlangen, den er nach Maß seiner Kräfte zu erreichen fähig war“. Es folgte 1810 die Einführung der Gewerbefreiheit, die den Zunftzwang beseitigte. Die Städteordnung brachte den größeren Gemeinden mehr Selbstverwaltung. Eine von Wilhelm von Humboldt nach 1809 begonnene Bildungsreform sollte die Fähigkeiten und Kräfte der Bürger auf breiter Grundlage entwickeln. Dem Aufstieg Preußens als europäische Großmacht sollte eine Heeresreform dienen. Sie wurde zwischen 1807 und 1814 vorangetrieben. Die aus Söldnern bestehende alte Armee wurde aufgelöst und nach französischem Muster in ein Volksheer umgewandelt. Alle männlichen Untertanen konnten fortan zum Militärdienst eingezogen werden. Im Emanzipationsedikt von 1812 wurde Juden die bürgerlichen Rechte gewährt; höhere Ämter in Justiz, Verwaltung und Militär blieben ihnen jedoch verwehrt. Gegen Napoleon England, Preußen, Russland und andere europäische Mächte lehnten sich gegen die französische Vorherrschaft auf. Nachdem die „Grande Armée“ 1812 in Russland eine halbe Million Menschen verloren hatte, beschloss Zar Alexander I., der seit 1801 Russland regierte, den Kampf zur „Befreiung“ Europas fortzusetzen. Doch erst als der preußische General Ludwig Yorck von Wartenburg ohne Zustimmung seines Königs Ende 1812 in der Konvention von Tauroggen den Russen den Weg nach Ostpreußen freigab, folgte Friedrich Wilhelm III. dem Signal zum Befreiungskrieg. Preußen erklärte Frankreich ebenfalls den Krieg und seine bürgerliche Elite versuchte, die Bevölkerung in allen deutschen Staaten mit nationalen Parolen zu mobilisieren (u M1). Mit mäßigem Erfolg, wie die historische Forschung inzwischen herausgefunden hat (u M2).* * Siehe auch S. 134. i Maueranschlag in Berlin. Nach der Niederlage von Jena und Auerstedt im Oktober 1806 ließ der Berliner Stadtkommandant dieses Plakat (15 x 18 cm) in Berlin anschlagen. p Der Historiker Gerhard Ritter schrieb zu diesem Anschlag: „Schulenburg hat [damit] gleichsam der versinkenden Epoche einen Grabstein gesetzt.“ Erläutern Sie diese Aussage. Oktoberedikt: Das Gesetz vom 9. Oktober 1807 leitete das Ende der Ständeordnung in Preußen ein. Es hob die Erbuntertänigkeit der Bauern auf, die somit persönlich frei wurden. Eigentümer des von ihnen bearbeiteten Landes konnten sie aber nur gegen eine Entschädigung an den Grundherrn (Regulierungsedikt vom 14. November 1811) werden, was nicht vielen gelang. DVD-Tipp: Napoleon und die Deutschen. Teil I-IV, ARD-Koproduktion/ Arte Edition, 2 DVDs, 2006 428 Europäische Friedensordnung nach den Napoleonischen Kriegen 4677_1_1_2015_424-451_Kap12.indd 428 17.07.15 12:17 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn e V er la gs | |
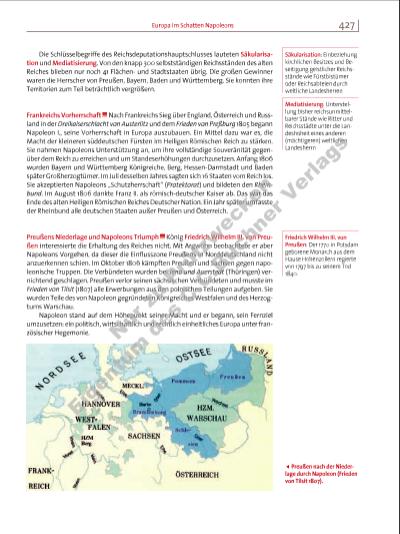 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |