| Volltext anzeigen | |
M1 Ein starkes Deutschland – im Interesse Europas Der preußische Reformer Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein wird 1812 Berater des russischen Kaisers, vermittelt 1813 das preußisch-russische Bündnis gegen Napoleon und nimmt 1814/15 als Mitglied der russischen Delegation am Wiener Kongress teil. Im September 1812 verfasst er in St. Petersburg eine Denkschrift, die auf die zukünftige Rolle Deutschlands eingeht: Das Glück der Waffen wird über das Schicksal Deutschlands und über die ihm zu erteilende Verfassung entscheiden. Die Aufl ösung des schändlichen Rheinbundes erfordert die Sicherheit von ganz Europa. Was soll aber an seine Stelle kommen? […] Es ist das Interesse Europas und namentlich Deutschlands, dass es zu einem kräftigen Staat erhoben werde, um Frankreichs Übermacht zu widerstehen und seine Selbstständigkeit erhalten zu können, um seine großen Ströme und seine Küsten England zugänglich zu erhalten, um Russland gegen französische Invasionen zu schützen. In dieser Absicht kann man das Land zwischen der Oder, dem Ausfl uss des Rheins, Maas und den Mosel-Gebirgen zu einem einzigen kräftigen Staat erheben, oder man kann dieses so begrenzte Deutschland nach dem Lauf des Mains zwischen Preußen und Österreich teilen, oder man kann einzelne Teile dieses Landes z. B. in ein untergeordnetes Verhältnis gegen Österreich und Preußen setzen, alle diese Einrichtungen geben Deutschland mehr Kraft als es bisher hatte, aber die Wiederherstellung der ehemaligen Reichsverfassung ist unmöglich. […] Ist die Wiederherstellung der alten Monarchie unmöglich, so bleibt die Teilung Deutschlands zwischen Österreich und Preußen der Wiederherstellung der alten Reichsverfassung vorzuziehen, selbst dann, wenn es nötig sein sollte, um den Egoismus zu schonen, die vertriebenen Fürsten wiederherzustellen und sie in ein föderatives Verhältnis mit dem Teil von Deutschland zu setzen, der sie einschließt. Zitiert nach: Die deutsche Verfassungsfrage 1812 1815, eingeleitet und zusammengestellt von Manfred Botzenhart, Göttingen 1968, S. 8 1. Erklären Sie, wie Stein die Rolle Deutschlands in Europa einschätzt und welche Möglichkeiten er für die künftige Gestalt Deutschlands sieht. H Erarbeiten Sie zur Veranschaulichung ein Schaubild. 2. Freiherr vom Stein erklärt, „die Wiederherstellung der ehemaligen Reichsverfassung ist unmöglich“ (Zeile 19 f.). Weisen Sie nach, warum diese Aussage zutraf. M2 Über den Mythos vom „Befreiungskrieg“ Die Tübinger Historikerin Ute Planert ist in einer 2007 veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit der Wahrnehmung und Bedeutung der „Befreiungskriege“ nachgegangen und kommt zu folgendem Ergebnis: Die Vorstellung, dass sich die deutsche Nation in den Kriegen gegen Napoleon gebildet habe, lässt sich in dieser pauschalen Form nicht länger aufrechterhalten. Schon der Blick auf Preußen und die Bildungseliten macht deutlich, dass einerseits Nationalbewusstsein und antifranzösische Stereotype unter den Gebildeten bereits lange vor der Französischen Revolution verbreitet waren, andererseits die Nationalbegeisterung 1813 nicht einmal in Preußen alle Regionen, Konfessionen und Bevölkerungsschichten erfasste. Dass die Spendenund Mobilisierungsbereitschaft mit dem geografi schen Abstand zur preußischen Hauptstadt abnahm und sich in den katholischen Gebieten Schlesiens kaum Unterstützung regte, lässt deutlich erkennen, dass es in erster Linie die Loyalität zur preußischen Monarchie war, welche die Menschen zu Hilfeleistungen motivierte. Daneben spielten bei der preußischen Kriegsmobilisierung antifranzösische Affekte infolge der ökonomischen Ausbeutung und der Belastung durch die Grande Armée eine wichtige Rolle. Die bewusste Hinwendung zur deutschen Nation blieb jedoch eine Position intellektueller Minderheiten. Selbst für die meisten der rund 500 Publizisten, welche den „Befreiungskrieg“ propagandistisch abstützten, bildeten patriotischpreußische und national-deutsche Vorstellungen noch eine unentwirrbare Gemengelage. Die starke religiöse Färbung gerade derjenigen Schriften, die sich – wie Arndts Kriegskatechismus1 – an ein breites Publikum richteten, zeigt, dass zur Mobilisierung breiter Bevölkerungsschichten das nationale Argument allein nicht ausreichte. Ute Planert, Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden: Alltag – Wahrnehmung – Deutung 1792 1841, Paderborn 2007, S. 655 f. 1. Skizzieren Sie Planerts Kritik am Mythos „Befreiungskrieg“. 2. Gewichten und kategorisieren Sie die Argumente gegen den Mythos, die deutsche Nation habe sich „in den Kriegen gegen Napoleon gebildet“ (Zeile 1 f.). Berücksichtigen Sie dazu auch Seite 134. 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 1 Der preußische Schriftsteller und Historiker Ernst Moritz Arndt (1769 1860) rief in seinem 1812 veröffentlichten „Kurzen Katechismus für teutsche Soldaten nebst einem Anhang von Liedern“ und seinem ein Jahr später publizierten „Katechismus für den teutschen Kriegsu. Wehrmann“ zum Kampf gegen den „Tyrannen“ Napoleon und alle seine Unterstützer auf. 430 Europäische Friedensordnung nach den Napoleonischen Kriegen 4677_1_1_2015_424-451_Kap12.indd 430 17.07.15 12:17 Nu r z u Pr üf zw ec en Ei ge nt um d es C .C .B uc hn r V er la gs | |
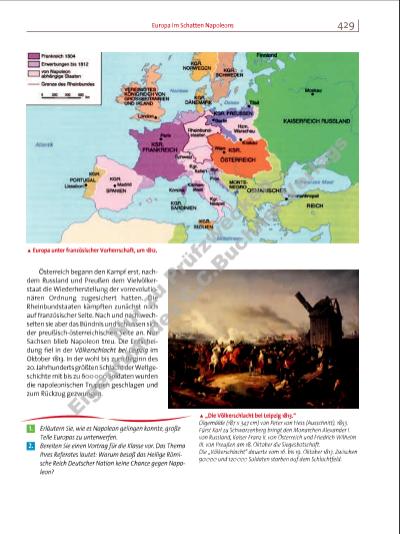 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |