| Volltext anzeigen | |
M1 Frieden und Freundschaft Aus dem Pariser Friedensvertrag zwischen Frankreich und den alliierten Mächten vom 30. Mai 1814: Da Seine Majestät der König von Preußen und Seine Alliierten an einem, und Seine Majestät der König von Frankreich und Navarra am andern Theile, ein gleiches Verlangen hegen, den langwierigen Erschütterungen von Europa und dem Unglücke der Völker durch einen festen, auf eine richtige Verteilung der Kräfte unter die Mächte, gegründeten, und in seinen Bestimmungen die Gewährleistung für seine Dauer enthaltenden Frieden, ein Ende zu machen, und Seine Majestät der König von Preußen und Seine Alliierten jetzt, wo Frankreich durch seine erfolgte Rückkehr unter die väterliche Regierung seiner Könige Europa ein Pfand der Sicherheit und der Beständigkeit gibt, von demselben diejenigen Bedingungen und Gewährleistungen nicht mehr erheischen wollen, welche Sie ungern unter einer vorigen Regierung von ihm gefordert hatten, so haben Ihre gedachte Majestäten Bevollmächtigte ernannt, um einen Friedensund Freundschafts-Vertrag zu unterhandeln, zu schließen und zu unterzeichnen […] 2. Art. Das Königreich Frankreich behält die Integrität seiner Grenzen, so wie selbige in dem Zeitpunkte am ersten Januar 1792 bestanden. […] 6. Art. […] Die Staaten Deutschlands werden unabhängig und durch ein föderatives Band vereinigt sein. […] 18. Art. Da die alliierten Mächte […] einen neuen Beweis ihres Verlangens geben wollen, die Folgen der durch den gegenwärtigen Frieden so glücklich beendigten Unglücksepoche verschwinden zu lassen, so leisten sie auf die Totalität der Summen Verzicht, welche die Staatsregierungen aus Kontrakten, für Lieferungen oder irgendwelche Vorschüsse […] an Frankreich zu fordern haben. […] 32. Art. Binnen einer zweimonatlichen Frist werden alle von einer oder der andern Seite in den gegenwärtigen Krieg verwickelt gewesene Mächte Bevollmächtigte nach Wien senden, um auf einem allgemeinen Kongresse die Vereinbarungen in Richtigkeit zu bringen, durch welche die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages vervollständigt werden sollen. Zitiert nach: Walter Demel und Uwe Puschner (Hrsg.), Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress 1789 1815, Stuttgart 1995, S. 72 75 (gekürzt) 1. Arbeiten Sie die Grundidee der Bestimmungen heraus und erläutern Sie diese anhand der Schlüsselbegriffe. 2. Beurteilen Sie die Konsequenzen des 6. Artikels für die deutsche Nationalbewegung. M2 Der Wiener Kongress – ein politisches Treffen Der Historiker Karl Griewank (1900-1953) über den Wiener Kongress: [A]lles, was der Kongress an politischen Ergebnissen zeitigte, [ging] von den Verhandlungen der Großmächte untereinander und mit den einzelnen Staaten aus. Der Kongress sei gar kein Kongress, sagte schließlich Metternich voller Zweideutigkeit, seine Eröffnung sei keine Eröffnung und seine Kommissionen keine Kommissionen; sein Vorteil bestehe nur darin, ein Europa „sans distance“ zu bilden, d. h. die tonangebenden Leiter der Großmächte zusammenzuführen und den Vertretern der ganzen europäischen Staatenfamilie gegenüberzustellen. Es war eine Spätblüte absolutistischer Diplomatie in gesellschaftlichem Gewande mit leicht gelockerten Formen, gehoben durch die noch auf keinem Gesandtenkongress erlebte gleichzeitige Anwesenheit der meisten Fürsten und zugleich popularisiert durch geringere Abschließung von der bürgerlichen Öffentlichkeit. […] Nach dem sinnvollen Sprachgebrauch, der sich eingebürgert hat, bezeichnen wir als Wiener Kongress im weiteren Sinne die Gesamtheit der diplomatischen Verhandlungen, Kämpfe und Abmachungen, die sich auf dem großen politischen Treffen in Wien vom September 1814 bis in den Juni 1815 abgespielt haben. Karl Griewank, Der Wiener Kongress und die europäische Restauration 1814/15, Leipzig 21954, S. 122 und 154 1. Fassen Sie Griewanks Aussagen zusammen. Wo gibt er Fakten wieder, wo interpretiert er? 2. Vergleichen Sie die Arbeitsund Rahmenbedingungen des Wiener Kongresses mit heutigen internationalen politischen Treffen. 3. Arbeiten Sie Übereinstimmungen und Unterschiede F zwischen dem Wiener Kongress und den Verhandlungen heraus, die 1648 zum Westfälischen Frieden führten (siehe S. 408 ff.). M3 „Sie kommen zu rechter Zeit …“ Der 1783 geborene französische Diplomat Auguste Graf de La Garde schildert in seinen Erinnerungen einen Besuch beim fast achtzig Jahre alten österreichischen Fürsten Charles Joseph Fürst de Ligne in Wien Ende 1814: Sie kommen zu rechter Zeit, um große Dinge zu sehen. Europa ist in Wien. Das Gewebe der Politik ist ganz mit Festlichkeiten durchsponnen. In Ihrem Alter liebt man die fröhlichen 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 434 Europäische Friedensordnung nach den Napoleonischen Kriegen 4677_1_1_2015_424-451_Kap12.indd 434 17.07.15 12:17 Nu r z Pr üf zw ec k n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn V er l gs | |
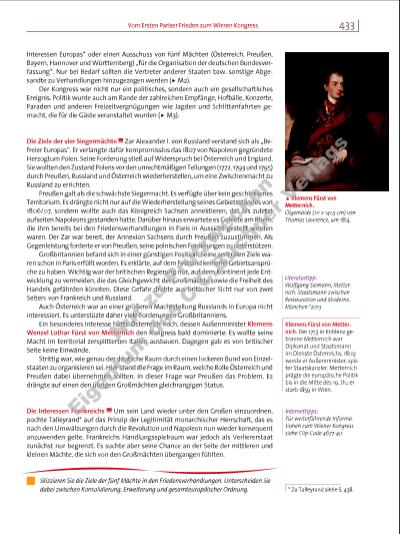 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |