| Volltext anzeigen | |
Grundlagen: Grundprinzipien staatlicher Sozialpolitik: Familienpolitik 223 Erläutern Sie, wodurch sich die vier farblich unterschiedenen Kreissegmente der Grafik zu den Lebensformen (S. 221) unterscheiden bzw. wie sie zusammenhängen (unterscheiden Sie den Familienvom Nicht-Familien-Sektor). Erörtern Sie, welche Aussagen sich vor dem Hintergrund der Grafiken und Texte zur Bedeutung von Familie und Ehe heute machen lassen und welche Vorgaben das Grundgesetz dabei formuliert. Beurteilen Sie die These, dass ein Wiederanstieg der Geburtenrate (hin zu Familien mit mehr als zwei Kindern) in Deutschland durchaus nicht ausgeschlossen ist. Beurteilen Sie vor dem Hintergrund der EU-Geburtenziffern die Bedeutung folgender These von Jürgen Dorbritz und Norbert F. Schneider (vgl. S. 214): „Angenommen wird, dass die soziale Institution Ehe mit den sie stützenden vielfältigen Rechten und Pflichten an Attraktivität verloren und sich für einen wachsenden Teil der Menschen in Europa eher zum Hindernis für die Verwirklichung individueller Lebensentwürfe entwickelt hat. In Ländern wie etwa den südeuropäischen, in denen nichteheliche Elternschaft weiterhin stigmatisiert [schlecht angesehen] ist, wirkt dieser Zusammenhang negativ auf das Geburtengeschehen.“ 1 2 3 4 1970: Ende der 70er-Jahre wird der Mutterschaftsurlaub eingeführt. Während dieses „Urlaubs“ dürfen Frauen bis auf freiwillige Ausnahmen nicht arbeiten und sind vor Kündigung geschützt. 1975 erhalten Eltern (ab 1988 auch Pflegeeltern) ab dem ersten Kind Kindergeld; es beträgt für das erste Kind im Jahr 50 DM, für das zweite Kind 70 DM und für das dritte 120 DM. 1980: 1985 wird das Erziehungsgeld eingeführt (bis 2007 gültig): Einer der Partner erhält unabhängig vom vorherigen Einkommen ein Jahr lang umgerechnet 450 Euro oder zwei Jahre lang 300 Euro (zudem ist Teilzeitarbeit möglich). 1990: Die Rentenversicherung erkennt drei Jahre der Kindererziehung für Rentenansprüche an. 1996 erhält jedes Kind zwischen drei und sechs Jahren per Gesetz Anspruch auf einen Platz im Kindergarten. Die Sätze für das Kindergeld werden mehr als verdoppelt. 2000: Beide Eltern können ab 2001 in den ersten drei Jahren gleichzeitig oder nacheinander in Teilzeit bis zu 30 Stunden pro Woche arbeiten oder ganz aussetzen („Elternzeit“). 2005 wird der Ausbau der Betreuung auch von Kindern unter drei Jahren in Kindertagesstätten – als Rechtsanspruch ab 2013 – gesetzlich geregelt. Familienpolitische Maßnahmen in Deutschland Chronologie der Familienpolitik 1950: Der Paragraf 1356 des Bürgerlichen Gesetzbuches lautet: „Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ Der Mann muss also erst zustimmen, wenn die Frau arbeiten will. Mütter müssen aber in aller Regel arbeiten, nur wenige können es sich leisten, zu Hause zu bleiben. Seit 1954 gibt es (wieder) Kindergeld: Es wird zunächst durch Arbeitgeberbeiträge finanziert und erst für das dritte und jedes weitere Kind der Arbeitenden gezahlt. 1960: Mitte der 60er-Jahre führt die Metallindustrie die 40-Stunden-Woche ein, für die sich Gewerkschaften starkgemacht hatten („Samstags gehört Vati mir“). Seit den 60er-Jahren wird das Kindergeld immer weiter erhöht. 1961 wird es bereits ab dem zweiten Kind gezahlt – und von nun an aus Steuermitteln (Bund). 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Nu zu P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d e C .C .B uc hn er V er la gs | |
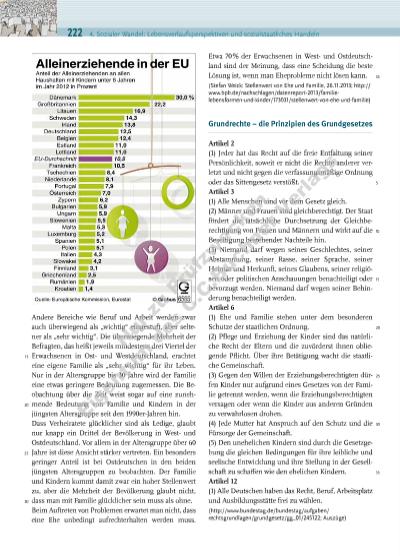 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |