| Volltext anzeigen | |
Vertiefung: Grundprinzipien staatlicher Sozialpolitik: Rentenpolitik 239 ternehmen das, was sie bei den Rentenbeiträgen sparen, über die Steuer wieder abzunehmen, um damit eine Zusatzrente für einen Teil der Arbeitnehmer hoch zu subventionieren. Das ließe sich theoretisch mit erwünschten Verteilungswirkungen rechtfertigen: Die Riester-Rente sollte erklärtermaßen neben Familien den Beziehern geringer Einkommen helfen, Geld für das Alter zurückzulegen. Das ist erkennbar und vorhersehbar nicht geglückt. Mit rund 25 Prozent ist die Quote derer, die einen Riester-Sparplan haben, bei den untersten 40 Prozent der Haushalte nach Einkommen weniger als halb so hoch wie beim obersten Fünftel. Das heißt: Drei Viertel der Hauptzielgruppe der Riester-Rente würden sich vermutlich besserstellen, wenn der Staat die Rentenabsenkung weniger drastisch hätte ausfallen lassen und dafür auf die teure Subventionierung der Riester-Rente verzichtet hätte. Die geringe Teilnahmequote ausgerechnet derer, die wenig verdienen und eine besonders geringe Rente haben werden, zeigt gleichzeitig das Scheitern einer zweiten möglichen Zielsetzung, nämlich für eine höhere Ersparnis für das Alter zu sorgen. Wer nicht mitmacht, kann auch nicht zu verstärktem Sparen angehalten werden. Wer nicht mitmacht, spart sogar durch die relative Absenkung der Rentenbeiträge weniger für das Alter als ohne diesen Politikwechsel. Doch die Reform hat nicht nur Verlierer. Neben den gut verdienenden Teilnehmern und den besonders begünstigten Eltern mehrerer Kinder profitiert vor allem die Finanzbranche. Deren Gebühren bei Riester-Produkten sind nicht gerade transparent und oft so hoch, dass sie über die Laufzeit der Pläne die staatliche Subvention auffressen. An der dafür gekürzten staatlichen Rente verdiente die Finanzbranche dagegen so gut wie nichts. Als die Riester-Beteiligung am Anfang zu wünschen übrig ließ, war denn auch die wichtigste Neuerung, den Anbietern ein früheres Abziehen der Abschlussgebühren zu erlauben. Das brachte den Durchbruch. (Norbert Häring: Stimmt es, dass…, in: Handelsblatt v. 15.5.2012, S. 16) Die Rente ist sicher – aber in welchem Alter? Sachverständigenrat und Deutsche Bundesbank fordern Rente mit 69 oder noch später Der größte Handlungsbedarf besteht im Bereich der Systeme der sozialen Sicherung, insbesondere in der gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese beiden Sozialversicherungen tragen zu einem erheblichen Teil zur Tragfähigkeitslücke in den öffentlichen Finanzen bei. So besteht derzeit in einem Basisszenario eine Tragfähigkeitslücke von 3,1 vH in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Ohne Konsolidierungsschritte läge die Schuldenstandsquote im Jahr 2060 bei etwa 270 vH. Dies hätte massive Verteilungsprobleme zur Folge, da zukünftige Generationen [über ihren gegenwärtigen Beitrag zur Rentenversicherung] zu stark belastet würden. Folglich muss die Politik mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern. So gilt es zunächst zwingend, die vorgesehene Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre im Jahr 2029 umzusetzen. Darüber hinaus sollte eine sich an der Entwicklung der Lebenserwartung orientierende regelgebundene Anpassung des Renteneintrittsalters eingeführt werden. Denn die fernere Lebenserwartung wird auch über das Jahr 2029 hinaus steigen, sodass sich die absolute Rentenbezugsdauer weiter verlängert. Dabei sollte die regelgebundene Anpassung zu einer Konstanz der relativen Rentenbezugsdauer führen. Das gesetzliche Renteneintrittsalter wird dann mit der höheren Lebenserwartung allmählich in den Jahren von 2030 bis 2060 ansteigen. Eine solche Anpassung hätte im Jahr 2045 vermutlich ein gesetzliches Renteneintrittsalter von 68 Jahren und im Jahr 2060 von 69 Jahren zur Folge, wobei für spezielle Berufe besondere Lösungen geprüft werden können. 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um de s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 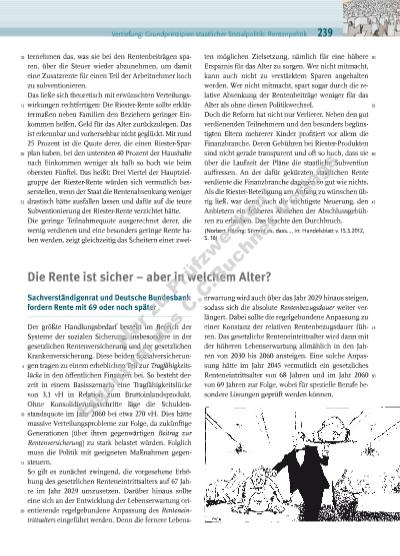 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |