| Volltext anzeigen | |
Annäherung und Planung: Streit um die Aufgaben des Staates 23 sich in zwei Seiten, in „Ja“ und „Nein“ teilt. Ziel ist diesmal nicht die Verständigung über eine gemeinsame Kompromisslösung, Meinungsverschiedenheiten sollen vielmehr erst einmal zum Vorschein kommen. Also: Auf die Entscheidung von jedem Einzelnen kommt es an … Der Ablauf: 1. Der Raum ist in einer Breite von etwa sechs Metern von Tischen, Stühlen etc. freigeräumt. Eine Seite wird zur „JA“-Seite bestimmt, die gegenüberliegende zur „NEIN“-Seite (Schilder). 2. Alle TN versammeln sich in der Mitte dieses Raums (wichtig: nach jeder These wieder neu!). 3. M liest eine Aussage zweimal vor. – Die TN entscheiden sich (erst!) nach dem zweiten Lesen und innerhalb von 10 Sekunden für „(eher) JA“ oder „(eher) NEIN“ und gehen zur entsprechenden Seite. Nur im „Notfall“ bleiben sie in der Mitte. 4. Die TN haben jederzeit die Möglichkeit, die Seite zu wechseln. 5. M fragt eine der Gruppen nach Gründen ihrer Entscheidung. Danach begründet die andere Gruppe ihre Entscheidung; zwischen den beiden Gruppen ergibt sich ein Dialog, da die beiden Seiten versuchen, ihr Gegenüber zu überzeugen … M koordiniert die Redebeiträge, nimmt aber selbst nicht an der Diskussion teil (!) und achtet darauf, dass möglichst viele TN an der Diskussion beteiligt werden. 6. Wenn sich eine Diskussion „festfährt“ oder alle die gleiche Position beziehen, wird eine neue Aussage vorgelesen. Alle Teilnehmer kommen vorher wieder in der Mitte zusammen. 7. Nach Gespür des Spielleiters – und möglichst nicht nach Zeitvorgabe – erfolgt der Abbruch des Verfahrens insgesamt. Im Zweifelsfall ist weniger mehr! 8. Die TN werten ihre Erfahrungen zum Spielverlauf aus: Gruppenzusammensetzungen, inhaltliche Schwerpunkte, besonders aufgeladene Situationen oder Argumentationen werden angesprochen und festgehalten: – Welche Entscheidung fiel besonders schwer und warum? – Welche Position war schwierig zu begründen, obwohl doch die Entscheidung dafür „ganz klar“ war? – Wie steht es mit den Erfahrungen in unterschiedlich großen Gruppen? – An welchen Stellen gab es inhaltliche Unsicherheiten, besteht ein Bedürfnis nach (Er-)Klärungen? (Franz-Josef Bölting: Didaktische Praxis Entscheidungsspiel, in: Gesellschaft – Wirtschaft – Politik, Leske und Budrich, Opladen, Heft 2/2002, S. 233 – 235) 10 mögliche Thesen: 1. Die wirtschaftliche Entwicklung müsste junge Menschen besonders interessieren. 2. Die Wirtschaft entwickelt sich sowieso von selbst; darum braucht man sich nicht zu kümmern. 3. Unsere Politiker schaffen es, für angemessenen Wohlstand zu sorgen. 4. Wenn ein großes Unternehmen in eine ernsthafte Krise gerät, sollte die Regierung finanziell helfen. 5. Der Staat sollte auf keinen Fall mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. 6. Eine gewisse Verschuldung des Staatshaushalts muss man in Kauf nehmen, wenn dadurch Arbeitslosigkeit abgebaut wird. 7. Ohne das ständige Wachstum der produzierten Gütermenge und der Dienstleistungen kann keine Wirtschaft bestehen. 8. Die EU sollte hohe Zölle auf importierte Waren erheben, um die hiesige Wirtschaft besser zu schützen. 9. Die Europäische Zentralbank in Frankfurt sollte sich vor allem darum kümmern, dass es möglichst wenig Arbeitslose gibt. 10. Es ist gut, dass wir in Europa eine gemeinsame Währung und Politik für alle Euroländer haben. Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
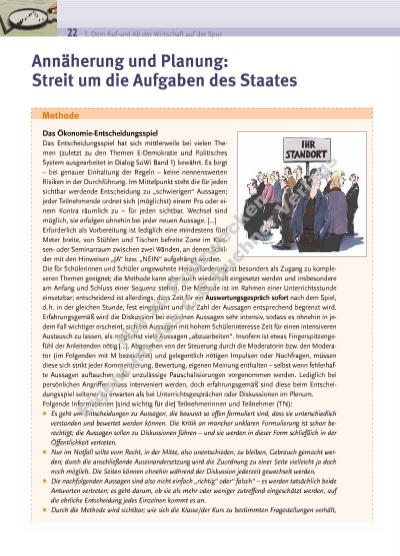 « | 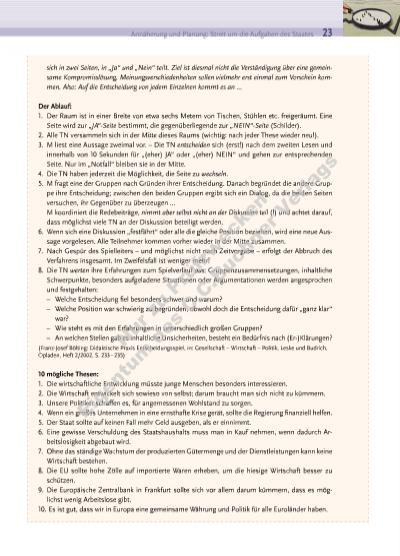 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |