| Volltext anzeigen | |
Vertiefung: Der Wirtschaftsstandort Deutschland in der Diskussion 73 Erörtern Sie die Chancen und Risiken der Forderungen, a) für eine deutliche Senkung der Exportüberschüsse zu sorgen, b) für deutlich höhere Löhne zu sorgen. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen diesen beiden Forderungen? Bearbeiten Sie die Kontroverse 1, S. 86 ff. Beurteilen Sie die Einschätzungen vor dem Hintergrund der nachfolgend vorgestellten „Agenda 2010“. 1 2 3 4 Lohnund Arbeitszeitpolitik: Agenda 2010 und die aktuellen Folgen Die Agenda 2010 als Antwort auf die Probleme seit den Siebzigerjahren Lange wurde in Deutschland darüber gestritten, ob die in den Siebzigerjahren entstandene [vgl. S. 59 ff.] und bis in die ersten Jahre dieses Jahrtausends währende hohe Arbeitslosigkeit durch zu hohe Löhne oder eine zu schwache Nachfrage verursacht wurde. Die Vertreter der ersten These forderten die „Deregulierung“ des Arbeitsmarkts, die Senkung von Lohnersatzleistungen und die Beschneidung der Macht der Gewerkschaften. Damit sollten von der Politik und Interessengruppen geschaffene Verzerrungen im Markt korrigiert und die Funktionsfähigkeit des Markts zum Ausgleich von Arbeitsangebot und Nachfrage wiederhergestellt werden. Die Vertreter der zweiten These wollten staatliche Programme zur Stimulierung der Nachfrage. Damit sollte eine aufgrund von Nachfragemangel entstandene unfreiwillige Arbeitslosigkeit korrigiert und das „Unterbeschäftigungsgleichgewicht“ überwunden werden. Der Streit entwickelte sich zu einem Glaubenskampf zwischen der neoklassischen Schule der Ökonomie einerseits, die die erste These vertrat, und der keynesianischen Schule andererseits, die die zweite These propagierte. Beide Seiten fuhren die schwersten ihnen zur Verfügung stehenden theoretischen und empirischen Geschütze auf. Den Kampf konnten sie damit aber nicht entscheiden. Über drei Jahrzehnte tobte die intellektuelle Auseinandersetzung, während die Arbeitslosigkeit von Rezession zu Rezession zunahm. Die Entscheidung im Kampf der Theorien brachte schließlich ein groß angelegtes Experiment der Regierung Schröder, das unter dem Namen Agenda 2010 in die deutsche Wirtschaftsgeschichte einging. Die Regierung von Gerhard Schröder lockerte die Beschränkungen für Zeitund Leiharbeit und senkte die Lohnersatzleistungen. Gleichzeitig orientierten Gewerkschaften und Arbeitgeber den Prozess der Lohnfindung unter dem Namen „Bündnis für Arbeit“ stärker an den betrieblichen Notwendigkeiten [vgl. Dialog SoWi, Band 1, Kapitel 3]. Die Konsequenzen dieser Politik waren Lohnzurückhaltung und -differenzierung sowie die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Das Ergebnis sehen wir heute: Wir haben Vollbeschäftigung, auch wenn das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts relativ niedrig ist. Der beinahe dreißig Jahre währende Streit wurde durch das Experiment der Agenda 2010 entschieden. […] Doch mit der Vollbeschäftigung einher entwickelten sich gefühlte Ungerechtigkeiten in der Einkommensverteilung und exorbitante Exportüberschüsse. […] (Thomas Meyer: Die Idee beruht auf einer Anmaßung, in: Handelsblatt v. 25.7.2014, S. 52) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Nu r z u Pr üf zw e ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 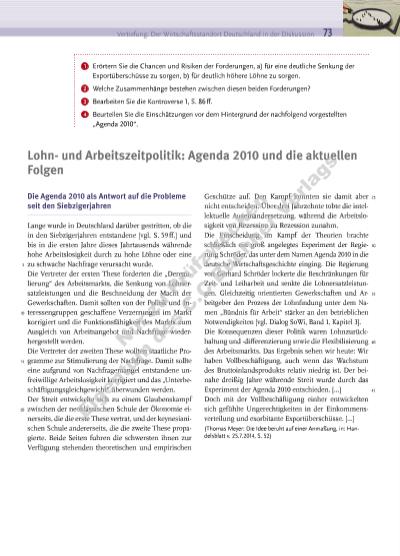 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |