| Volltext anzeigen | |
liche Ton der Sprache. Im Mittelalter erlebte das Epos als höfi scher Versroman eine Blüte, z. B. „Parzival“ (um 1200) oder das „Nibelungenlied“(1210). (P Kapitel 7) s Fabel: Handlung wird meist von sprechenden Tieren getragen, die typische menschliche Verhaltensweisen und Eigenschat en verkörpern. Fabeln wollen unterhalten, aber auch auf Fehlverhalten aufmerksam machen. Am Ende einer Fabel steht deshalb meist eine Moral. Die Fabel ist eine sehr alte literarische Form, die bekanntesten Fabeldichter waren der Grieche Aesop (6. Jh. vor Chr.), Phaedrus (griechischer Sklave in Rom) und Jean de la Fontaine (18. Jh.). (P Unterkapitel Fabeln 1.2 aus Kapitel 9) s Erzählung: meist längerer, ästhetisch konzipierter Text, der nicht die Breite eines Romans aufweist und keinen spezifi schen dramatischen Aub au wie etwa die Novelle besitzt. Wie im Roman können – je nach Entstehungszeit und/oder Autorenintention – verschiedene Erzählkonzepte zur Anwendung kommen. (P Kapitel 3) s Kurzgeschichte: Textsorte mit einem ersten Höhepunkt in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, zeigt Parallelen mit der amerikanischen Short Story. In der Regel gilt: Auf wenige Seiten beschränkter Erzähltext mit of enem Anfang und of enem Schluss. Im Mittelpunkt steht ein Wendepunkt im Leben eines Durchschnittsmenschen oder auch Außenseiters. Die Sprache ist nüchtern und alltäglich. Die Handlung spielt in der Welt und Zeit, in der die Kurzgeschichte entstanden ist. Entsprechend der künstlerischen Freiheit sind im Einzelnen Abweichungen möglich. Bekannte Vertreter sind Wolfgang Borchert (1921 – 1947) und Heinrich Böll (1917 – 1985). (P Kapitel 3) s Märchen: meist kürzere fantastische Prosaerzählung, frei erfunden, ohne Bezug zu einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Ort. Es geschehen Dinge und es treten Gestalten auf, die in der realen Welt wunderbar erscheinen. Bestimmte Merkmale sind für Märchen typisch: • Es treten gute und böse Gestalten als Gegenspieler auf. • Es gibt eine Heldenfi gur, die Abenteuer und Prüfungen zu bestehen hat. • Meist spielen besondere Gegenstände, Krät e oder magische Zahlen eine wichtige Rolle (z. B. die Zahlen 3 und 7). • Auch Sprüche und Verse kommen vielfach vor. • Raum und Zeit bleiben unbestimmt (Es war einmal …). • Die meisten Märchen gehen gut aus, d. h. dem Helden gelingt es, die Aufgaben und Prüfungen zu bestehen, das Böse wird besiegt. Viele Märchen stammen aus dem Orient, aber auch in allen anderen Ländern dieser Erde wurden und werden Märchen erzählt. Die bekanntesten deutschen Märchen wurden von den Brüdern Grimm (Jacob Grimm [1785 – 1863] und Wilhelm Grimm [1786 – 1859]) nach mündlicher Überlieferung gesammelt und herausgegeben. Üblich ist die Unterscheidung zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. 237Epik N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
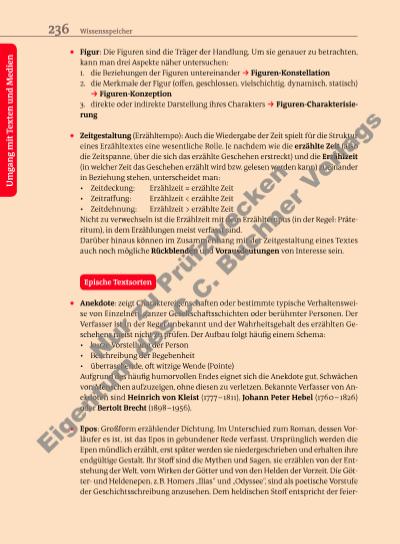 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |