| Volltext anzeigen | |
7So findet ihr euch im Buch zurecht Teilkapitel – das Wichtige, übersichtlich geordnet Auf der linken Seite haben die Verfasser aufgeschrieben, was sie für wichtig halten. Hier erfahrt ihr das Wesentliche zum Thema. Neue Lernbegriffe sind fett gedruckt und werden unten wiederholt. Hier zeigt der Fettdruck, welche Begriffe der Bildungsplan als besonders wichtig bezeichnet. Das euch schon bekannte Symbol oben zeigt, welche Kategorie vor allem behandelt wird. Außerdem enthält das Buch viele Materialien. Diese Texte, Bilder und Zeichnungen sind mit gekennzeichnet und nummeriert. Mit ihnen könnt ihr eigenständig arbeiten. Die Zeitleiste enthält die Daten der Doppelseite. Arbeitsvorschläge stehen unten rechts. Zu kniffligen Fragen geben wir Hilfen. Methoden – Aufgaben schrittweise lösen Wer die Geschichte verstehen will, muss die richtigen Fragen stellen und zu ihrer Beantwortung schrittweise vorgehen. Dafür braucht ihr Methoden. Wir zeigen euch an Beispielen, wie ihr Material auswertet. Auf den Methodenseiten könnt ihr das gleich selbst erproben: 1 bearbeiten wir mit euch gemeinsam. Jetzt bist du dran: Zu 2 machen wir keine Vorschläge. Mit den Hilfen zur Formulierung könnt ihr diese und kommende Aufgaben sicher allein lösen! „Fenster zur Welt“ – Einblick in andere Kulturen Ein Haus ohne Fenster wäre etwas ziemlich Merkwürdiges: Man könnte nur die Dinge in seiner eigenen Wohnung sehen. Was draußen vorgeht, bliebe unsichtbar. Für den Durchblick braucht man auch den Ausblick. Solche Ausblicke stellen die „Fenster zur Welt“ dar. Sie ermöglichen euch Einblicke in andere Kulturen, die zu anderen Zeiten auf anderen Erdteilen gelebt haben. Sie verdeutlichen euch aber auch, wie eines mit dem anderen zusammenhängt und wie es zu Begegnungen zwischen Menschen kam – über tausende von Kilometern hinweg. 136 137 5 Methode Botschaften auf Münzen entschlüsseln Münzgeschichte(n) Stell dir vor, du bist römischer Kaiser und möchtest beim Volk für dich als Herrscher werben. Doch wie erreichst du Millionen von Untertanen? Welche „Reklame“ lässt sich leicht von Nordafrika bis Britannien verbreiten und wandert dabei noch ganz von selbst von Hand zu Hand? Die Münze! Über Jahrhunderte nutzten die Römer ihre Münzen nicht nur als Zahlungsmittel. Auf Vorderund Rückseite prägten sie Bilder, Texte und Zeichen, um politische Botschaften und Meinungen unters Volk zu bringen. Zur Zeit der Republik zeigten die Münzen vor allem römische Gottheiten, Sagen oder römische Tugenden, die das Selbstverständnis der Römer gegenüber anderen Stämmen und Völkern ausdrückten. Später brauchten die Kaiser die Zustimmung der Bevölkerung im ganzen Reich, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen und zu sichern. Deshalb ließ nun jeder Princeps Geldstücke prägen mit seinem Porträt, seinem Namen, seinen (Ehren-)Titeln und weiteren Symbolen und Bildnissen, je nach beabsichtigter „Werbe-Botschaft“. Für uns heute sind römische Münzen ergiebige Quellen, die uns Aufschluss geben über Zeitumstände, politische Ereignisse und Entwicklungen oder über Absichten und Haltungen der Auftraggeber. Es ist also sehr lohnenswert, sie zu untersuchen und ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Dabei kannst du folgendermaßen vorgehen: Schritt 1: Was sehe ich? Was bedeutet das? (beschreiben und entschlüsseln) Welche Personen, Gegenstände, Symbole, Inschriften (Legenden) usw. sind zu erkennen? Wofür stehen die Bilder, was besagt die Legende? Schritt 2: Was weiß ich über die Hintergründe? (in Zusammenhang einordnen) Aus welcher Zeit stammt die Münze? Auf welche Personen oder Ereignisse bezieht sie sich? Welche politischen Verhältnisse herrschten damals? Schritt 3: Was ist die Botschaft? (Aussage formulieren) Was soll dem Betrachter mitgeteilt werden? Welche Überzeugung soll ihm nahe gebracht werden? Schritt 4: Was lerne ich daraus? (Fazit ziehen) Welche neuen Erkenntnisse habe ich gewonnen? Wo sehe ich Verbindungen zu bereits Gelerntem? Welche grundlegenden Fragen kann ich nun besser beantworten als zuvor? Zu klein für große Erklärungen – Münzabkürzungen Münzen haben keinen Platz für lange Texte. Zum Glück kannten viele Römer die Abkürzungen, die sie auf Münzen lesen konnten. Eine kleine Auswahl: C oder CAES Caesar; zuerst „Familienname“, dann verwendet als „Kaiser“ oder „künftiger Kaiser“ AVG Augustus; Beiname der Kaiser seit der Verleihung an Octavian 27 v. Chr. F Filius; also Sohn eines Herrschers DIC Diktator COS Konsul DIV(VS) Divus; der Göttliche, auch als Genitiv: Divi IVLIV(S) Julius; aus der Familie der Julier, also Julius Caesars IMP Imperator; zunächst Ehrentitel eines siegreichen Feldherrn, ab Augustus gleichbedeutend mit „Kaiser“ SPQR Senatus Populusque Romanus; Senat und Volk Roms Die wichtigsten Bildmotive und Symbole Viele Römer konnten nicht lesen. Aber auch sie verstanden die Botschaften der Münzen. Denn ihre Bildmotive konnte fast jeder deuten. Eine Auswahl: Lorbeerkranz Zeichen der römischen Könige, Siegeszeichen der Feldherren Gottheit Tugend/positive Eigenschaft, z.B.: Mars = Kriegsgott, Caeres = Göttin der Fruchtbarkeit, Concordia = Göttin der Eintracht kleine geflügelte Victoria, Siegesgöttin Gestalt zwei gleiche Reiter Castor und Pollux, Söhne Jupiters, stehen für Zusammenhalt und gegenseitige Treue Zepter/Stab Herrscherzeichen Stern/Sonne Göttlichkeit Frau mit geflügelte Roma, römische Stadtgöttin, Helm etwa wie Athene, Stadtgöttin der Athener Stab mit „Schnecke“ Zeichen des obersten Priesters am Ende Getreide/Ähre Getreideversorgung, Zeichen von Reichtum und Wohlstand So könntest du diese Münze beschreiben und auswerten: Schritt 1: Vorderseite: Porträt einer Frau mit Flügelhelm Rückseite: zwei Reiter mit Lanzen und wehenden Mänteln Legende: Vorderseite keine, Rückseite ROMA Die abgebildete Frau ist Roma, die Stadtgöttin der Römer. Die Reiter sind die Zwillinge Castor und Pollux. Schritt 2: Zeit: geprägt zwischen 211 und 170 v. Chr. Ereignis: zweiter Punischer Krieg (endet 202 v. Chr. mit Sieg Roms über Karthago und Einrichtung der Provinz Spanien) Politische Verhältnisse: Römische Republik Schritt 3: „Wir Römer sind stolz auf unsere Stadt. Wir sind das mächtigste Volk weit und breit. Kein Feind kann uns etwas anhaben, denn wir halten zusammen und sind einander treu.“ Schritt 4: Erkenntnisse: Selbstbewusstsein und Tugenden der Römer als überlegenes Volk; Abgrenzung gegenüber anderen Völkern im Mittelmeerraum (vielleicht gegenüber den Karthagern). Die Münze diente entweder als „Mutmacher“ (während des Krieges) oder als Zeichen des Triumphs (nach Kriegsende) Verbindungen: S. 124 f. – Rom wird durch die Punischen Kriege zur Großmacht Nützliche Sätze bei der Auswertung von Münzen: Schritt 1: Die Vorderseite / Rückseite der Münze zeigt … Folgende Legenden kann ich lesen: … Das Symbol ... bedeutet … Bei der abgebildeten Person handelt es sich um … Schritt 2: Die Münze stammt aus der Zeit … Wichtige Personen waren damals … Die Situation / das Problem zu dieser Zeit war … Schritt 3: „Ich bin ...“, „Wir wollen …“, „Ich kann ...“ (Lass den / die Urheber der Münze zu Wort kommen) Schritt 4: Die Münze hat mir verraten, dass … Dies kenne ich schon aus der Beschäftigung mit … Dies lässt sich vergleichen mit … Durch die Beschäftigung mit der Münze … Zu diesem Thema würde ich gern noch wissen … 1 Silbermünze (Denar) Geprägt in Rom, 211 170 v. Chr. 2 Silbermünze (Denar) Geprägt in Rom, 19 18 v. Chr. Jetzt bist du dran: Eine Münze auswerten Arbeite aus M2 heraus, was du über den Münzherrn Octavianus Augustus erfährst. Castor und Pollux waren in der griechischen und römischen Mythologie zwei unzertrennliche Zwillinge. Castor war sterblich, Pollux dagegen unsterblich. Als Castor im Kampf getötet wurde, bat Pollux den Zeus, ihm die Unsterblichkeit zu nehmen, damit er wieder mit seinem Bruder zusammen sein kann. Im Juli 44 v. Chr. war dieser Komet sieben Tage am Himmel Roms zu sehen, auch tagsüber! Dies hielten viele Römer für ein Zeichen, dass Julius Caesar in den Götterhimmel aufgestiegen war. Augustus ließ kurz danach seinem Adoptivvater Caesar einen Tempel bauen. Das Standbild Caesars darin trug den Kometen auf der Stirn. DIVVS IVLIV(S) = Divus Iulius („vergöttlichter Julius“) CAESAR AVGVSTVS = Caesar Augustus 174 175 6 Fenster zur Welt: Der Islam Arabisches Wissen – von Algebra bis Zucker Vielfalt und Toleranz Durch die schnelle und weite Ausdehnung ihres Machtgebietes kamen die Muslime immer wieder in Kontakt mit Christen: in den eroberten Bereichen des Byzantinischen Reiches, in Nordafrika (eine der wichtigsten Regionen des frühen Christentums) und vor allem im Süden Spaniens. Gerade im muslimischen Spanien, das auf Arabisch al-Andalus genannt wurde, konnten die christlichen Bewohner viel von ihren neuen Herren lernen. Die Muslime waren Experten auf dem Gebiet der Architektur und der Landwirtschaft. Sie ließen prächtige Paläste wie die Alhambra in Granada erbauen, wo es Springbrunnen und kühle Innenhöfe gab. Trotz des sehr heißen und trockenen Klimas konnten die Araber mit ihren Kenntnissen über Bewässerung das südliche Spanien zum Blühen bringen. Die großen Städte im muslimischen Spanien wie Toledo oder Córdoba waren berühmt für ihre Schulen und erstklassigen Krankenhäuser – und für eine gewisse Toleranz. Mehr als in anderen eroberten Gebieten herrschte hier ein Klima des gegenseitigen Respekts und der religiösen Vielfalt. Das Wissen der Araber verändert Europa Die arabische Wissenschaft war ihrer Zeit weit voraus: In Disziplinen wie Medizin, Geografie, Astronomie oder Mathematik waren die Araber auf einem Kenntnisstand, der in christlichen Gebieten erst viele Jahrhunderte später erreicht wurde. Zahlreiche Schriften der römischen und griechischen Antike wurden von arabischen Gelehrten gesammelt und aufbewahrt. So fanden sie über Umwege ihren Weg ins christliche Europa. Dadurch, dass es gerade in Spanien einen regen Austausch zwischen Muslimen, Juden und Christen gab, gelangten viele Erkenntnisse und Fertigkeiten in die anderen europäischen Regionen. Oftmals übernahm man dann nicht nur das neue Wissen, sondern gleich die entsprechenden Begriffe mit dazu – man spricht dann von einem Lehnwort. Einigen dieser Lehnwörter, die wir heute noch benutzen, sieht man ihre arabische Herkunft gar nicht an: Zucker, Gitarre, Admiral (von arab. Emir: Befehlshaber), Algebra, Ziffer. Die beiden letzten Lehnwörter zeigen, in welchem Bereich wir den mittelalterlichen Arabern am meisten verdanken. Sie haben das indische Zehner-Zahlensystem weiterentwickelt. Zwar dauerte es ungewöhnlich lange, bis die zum Rechnen und Zählen viel unpraktischeren römischen Zahlen wirklich abgelöst wurden. Doch dafür blieben die Arabischen Zahlen dann auch in ganz Europa und in vielen anderen Ländern der Welt in Gebrauch – bis heute. 1 Islamische Gelehrte beobachten den Himmel Holzschnitt, Venedig, 1513 Der Holzschnitt zeigt arabische Wissenschaftler, die Messungen mit astronomischen Instrumenten durchführen. 2 Beschreibung des Auges Hunayn ibn Ishaq, Zehn Abhandlungen über das Auge, verfasst um 860; syrische Buchmalerei aus dem Jahr 1197 Das verschollene Original stammt aus dem Jahr 860. Es enthält die älteste bekannte Darstellung der Augenmuskeln. 5 Weltkarte des arabischen Geografen Al-Idrisi, 1154 Die Araber zeichneten Karten so, dass Süden am oberen Kartenrand lag. Heute sind Karten nach Norden ausgerichtet. Wenn du das Buch drehst, erkennst du, wie genau diese Karte die Umrisse Europas zeigt. 3. Überprüfe die Behauptung, dass die islamischen Gebiete in der Zeit um etwa 800 bis 1000 deutlich fortschrittlicher waren als die christlichen Gegenden Europas (M1 M3). 4. Betrachte die Karte M5 und vergleiche sie mit der heutigen Europakarte hinten im Buch. Bewerte danach die Leistung dieser sehr alten Karte. 1. Zähle drei dreistellige Zahlen schriftlich zusammen – einmal mit römischen Ziffern, einmal mit arabischen. Was fällt auf? (M4) 2. Informiere dich über die medizinische Versorgung im Europa des Mittelalters. Vergleiche danach deine Ergebnisse mit den medizinischen Verhältnissen, die im Bagdader Krankenhaus (M3) herrschten. religiöse Vielfalt Wissenschaft Lehnwort Lesetipp: Jim Al-Khalili, Im Haus der Weisheit. Die arabischen Wissenschaften als Fundament unserer Kultur, Frankfurt am Main 2011 3 Ein Krankenhaus aus dem 10. Jh. Der berühmte arabische Reisende Ibn Dschubair beschreibt 1185 das seinerzeit bereits 200 Jahre alte Al-Muqtadiri-Krankenhaus in Bagdad: Diese großartige Einrichtung ist ein schönes Gebäude, welches sich entlang des Tigris-Ufers erstreckt. Seine Ärzte machen jeden Montag und Donnerstag Visite, um die Patienten zu untersuchen und ihnen je nach Bedarf etwas zu verschreiben. Den Ärzten stehen Diener zur Verfügung, die Rezepte für Arzneien ausstellen und das Essen bereiten. Das Krankenhaus ist in verschiedene Stationen unterteilt, von denen jede eine Anzahl von Zimmern umfasst. Dies vermittelt den Eindruck, als sei der Ort ein Königspalast, in dem alle Bequemlichkeiten geboten werden. Ibn Jubayr, The Travels of Ibn Jubayr, Text und Übersetzung nach Al-Khalili, Im Haus der Weisheit, a. a. O., S. 235 4 Rechnen – römisch oder arabisch? Bis ins späte Mittelalter ist in Europa fast nur mit Römischen Zahlen gerechnet worden: Römische Zahlen werden so gebildet: Im Normalfall werden die Zahlzeichen hintereinander geschrieben, die größte zuerst, dann die kleineren. Die Zahlzeichen werden dann im Kopf addiert. XVI wäre also X (zehn) + V ( fünf)+ I (eins) = 16. Die Sonderregel lautet: Wenn ein neues Zahlzeichen beginnt, wird das Zeichen der nächstkleineren (oder zweitnächstkleineren) Einheit links davon geschrieben. Dies wird dann subtrahiert: IV ist also V ( fünf) – I (eins) = 4, genauso ist XC somit C (hundert) – X (zehn) = 90. Bei den Arabischen Zahlen gibt es all dies nicht. Sie werden so gebildet, wie du es aus dem MatheUnterricht seit der ersten Klasse gewohnt bist. Eigenbeitrag Markus Benzinger 5 10 5 10 römische Zahl arabische Zahl I 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 VII 7 VIII 8 IX 9 X 10 XX 20 XL 40 XLIX 49 L 50 XC 90 C 100 CC 200 CD 400 D 500 M 1000 MDCCC 1800 166 167 6 Von der Spätantike ins Mittelalter Der heilige Gallus und der Bär Als Gallus sich nach dem Essen ans Lagerfeuer zum Schlafen legte, kam ein Bär und fraß die Reste seiner Mahlzeit. Gallus erwachte und befahl dem Bären, damit aufzuhören und stattdessen Holz zu sammeln und beim Feuer nachzulegen. Der Bär gehorchte. Diese Legende (Heiligenerzählung) entstand um das Jahr 610. An der Stelle, wo dies angeblich geschah, steht heute die Schweizer Stadt St. Gallen. Deren Stadtwappen zeigt einen Bären, der Holz sammelt. Aber wer war dieser Gallus? Wo kam er her und was tat er in der Nähe des Bodensees? Gallus war ein Schüler des irischen Mönches Kolumban. Beide kamen in das heutige Süddeutschland und die Nordschweiz, um ihren Glauben, das Christentum, dort zu verbreiten. Mitteleuropa wird christlich Diesen Vorgang nennt man Missionierung. Vom späten 6. Jh. an kamen weitere Mönche aus Irland oder Schottland und gründeten Klöster (Pirmin auf der Reichenau, Emmeram in Regensburg). Die einzelnen Kirchen wurden zu Bistümern („Gemeinschaften“) zusammengefasst, auch hier wirkten die Missionare mit. Aus vielen Kirchen wurde die Kirche. Im 8. Jh. waren es dann vor allem englische Mönche wie Bonifatius, der ursprünglich Winfried hieß, die in der Mitte und im Nordosten des heutigen Deutschland wirkten. Bonifatius wurde von Der neue Glaube kommt nach Mitteleuropa den fränkischen Hausmeiern1 unterstützt, die ein Interesse daran hatten, heidnische Germanen zu Christen zu machen. So hatten die Herrscher und ihre Untertanen die gleiche Religion. Im Fall des Bonifatius nahm dieser Versuch zuletzt einen tödlichen Ausgang: Als er den Friesen das Christentum bringen wollte, wurde er erschlagen. Das Christentum, die Klöster und das Alphabet Dass Gallus, wie auch andere Missionare, es mit wilden Tieren zu tun bekam, war kein Zufall. Die Landschaft Mitteleuropas war noch kaum von Menschen bewohnt. Es gab große Waldund Sumpfgebiete und alle Arten wilder Tiere, darunter Wölfe und Bären. Viele der neu gegründeten Klöster veränderten das Land in ihrer Umgebung. Die Mönche legten Felder, Gärten und Fischteiche an, ließen Straßen und Wege bauen und schufen so oft den Anfang einer Zivilisation. Wir wissen heute über all dies so gut Bescheid, weil die Missionare etwas ungeheuer Wichtiges mitgebracht haben: das lateinische Alphabet. Zuvor konnte kaum ein Germane oder Franke lesen. Es gab zwar eine Schrift (Runen), aber es war mühsam und zeitraubend, diese zu schreiben. Durch das Christentum, das eine „Buchreligion“ ist, kam die lateinische Sprache und das Alphabet, wie wir es heute noch verwenden, in unsere Gegend. Um 750 entstanden dann die ersten Texte auf Deutsch – als einer der älteststen das Vaterunser. 1 Der Hl. Bonifatius missioniert und stirbt als Märtyrer Buchmalerei (15,8 x 7,2 cm) aus Fulda, um 975 Das Bild zeigt zwei Szenen aus dem Leben des Hl. Bonifatius. Missionierung Kirche Alphabet 4 Reliquiar von Ennabeuren Höhe 8,9 cm, Breite 8,6 cm, um 650 In solchen kleinen Behältern wurden kostbare Reliquien – also Überreste von Heiligen wie z. B. Knochensplitter oder Teile der von ihnen getragenen Kleidung – aufbewahrt und transportiert. Die Umhüllung mit vergoldetem Kupferblech zeigt, wie wichtig den Menschen diese Reliquien waren. Info: Vaterunser So schrieb es vor 1200 Jahren ein Mönch am Bodensee in der damaligen deutschen Sprache („uu“ ist „w“): Fater unsar, thû pist in himile, uuihi namun dînan. qhueme rîhhi dîn. uuerde uuillo diin, sô in himile sôsa in erdu. prooth unsar emezîch kip uns hiutû. oblâz uns sculdî unsarô, so uuir oblâzem uns sculdîkêm. enti ni unsih firleiti in khorunka. ûzzer lôsi unsih fona ubile. – Amen. 2 Handschrift einer Klosterregel Aus der Bibliothek des Klosters St. Gallen Dieses Buch ist um 790 in lateinischer Sprache abgeschrieben worden. Damit auch Mönche, die kein Latein beherrschen, etwas verstehen, sind zwischen den Zeilen („interlinear“) Worterklärungen und Übersetzungen auf Deutsch eingetragen. 3 Eine päpstliche Empfehlung Den Missionaren, die zur Bekehrung der germanischen Völker in England aufgebrochen sind, sendet Papst Gregor I. diesen Rat: Man soll die heidnischen Tempel des Volkes nicht zerstören, sondern nur die Götzenbilder darin. Dann soll man die Tempel mit Weihwasser besprengen, Altäre errichten und Reliquien niederlegen. Denn wenn diese Tempel gut gebaut sind, ist es gut, sie von Orten des Dämonenkults zu Orten der Verehrung des wahren Gottes umzuwandeln. Wenn das Volk sieht, dass seine Tempel nicht zerstört sind, wird es umso eher den Irrtum aus seinem Herzen verbannen und den wahren Gott anbeten. Auf keinen Fall darf man den heidnischen Menschen nämlich alles auf einmal nehmen, da sie sonst zu Trotz und Widerwillen neigen. Beda Venerabilis, Kirchengeschichte Englands I.30 (übers. von Markus Benzinger, vereinfacht) 5 Wie christlich waren die Menschen nach der Missionierung? Zu den wenigen erhaltenen Texten in deutscher Sprache aus dem frühen Mittelalter gehören Zaubersprüche und Segen: Zweiter Merseburger Zauberspruch: Phol und Wotan [Namen germanischer Götter] ritten in den Wald. Da verrenkte sich Baldurs Pferd den Fuß. Da besprach es Sinthgund, die Schwester der Sonne, da besprach es Freia, die Schwester der Volla, da besprach es Wotan, so gut er konnte: Knochenverrenkung ist Blutverrenkung, ist Gliederverrenkung. Knochen zu Knochen, Blut zum Blut, Glied zum Glied. So sollen sie fest zusammengefügt sein. Beschwörungsformel gegen eine Krankheit, die man „Lahmen“ nennt: Christus und der heilige Stephan kamen zur Stadt Salonium [ Jerusalem?]. Da wurde das Pferd des heiligen Stephan von einer Krankheit befallen. Wie Christus das Pferd des heiligen Stephan heilte, so heile ich mithilfe von Christus dieses Pferd. Ein Vaterunser. Wohl, Christus, heile durch deine Gnade dieses Pferd, so wie du einst das Pferd des heiligen Stephan heiltest. Amen. Zit. nach: Karl Wipf, Althochdeutsche poetische Texte althochdeutsch/neuhochdeutsch, Stuttgart 1992, S. 65 67 (vereinfacht) 3. Beurteile, wie ernsthaft und tief gehend Menschen in Mitteleuropa den christlichen Glauben angenommen haben (M3, M5). 4. Überprüfe die Behauptung, dass mit der Missionierung die Zivilisation nach Mitteleuropa gelangt ist (Darstellungstext, M2, M4). 1. Die beiden Zaubersprüche in M5 sind etwa zur gleichen Zeit entstanden, der eine in ostfränkischem, der andere in sächsischem Dialekt. Vergleiche die Zaubersprüche: Wo liegen Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? 2. Erläutere, wie der christliche Glaube in Mitteleuropa verbreitet wurde (M1 M3). 500 550 600 700650 750 800 754: Der Missionar Bonifatius stirbt den Märtyrertod Mission durch Iren und Schotten Mission durch Engländer (Angelsachsen) 5 10 5 10 1 Siehe S. 164. Nu r z u Pr üf zw c en Ei ge nt um d es C .C .B u ne r V la gs | |
 « | 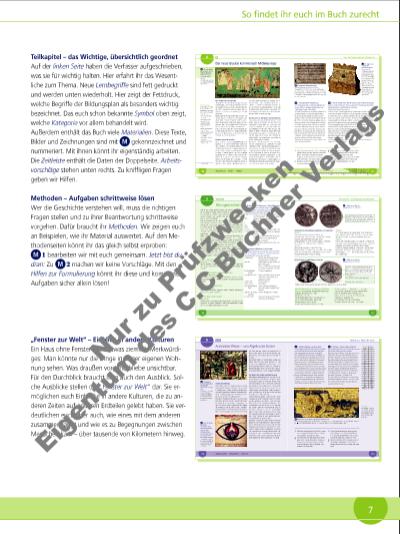 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |