| Volltext anzeigen | |
1519.1 Wodurch ist die Weltwirtschaft gefährdet und wer kümmert sich darum? M 3 Ist der traditionelle Nationalstaat in der Lage, die neuen Risiken zu beherrschen? Der moderne Nationalstaat bildet sich im Laufe des 16. Jahrhunderts heraus und wird mit dem Westfälischen Frieden von 1648 zum dominanten Akteur internationaler Beziehungen. Er ist definiert durch ein eindeutig umrissenes Territorium, einem Staatsvolk sowie einer souveränen Ausübung von Staatsgewalt. Er war auch der wichtigste Akteur in der bipolaren Welt bis 1990. In dieser Welt war die Ordnung durch das übersichtliche und festgefügte Zwei-Parteien-Nullsummenspiel geprägt. Das staatenzentrische Weltbild war durch überschaubare Freund-Feind-Schemata gekennzeichnet. Die Krise des Nationalstaats formulierte der amerikanische Soziologe Daniel Bell so: „Der Nationalstaat ist für die kleinen Probleme zu groß und für die großen Probleme zu klein geworden“. Der Nationalstaat wird von zwei Seiten in die Zange genommen: durch die zunehmend transnationalisierenden und globalisierenden gesellschaftlichen Handlungszusammenhänge einerseits, durch die Kräfte der Abgrenzung und Fragmentierung andererseits. Der zunehmende Machtverlust der Nationalstaaten angesichts dieser globalen Probleme wird mit den Schlagworten „Denationalisierung“ und „Entgrenzung“ bezeichnet. Welche weiteren Antworten werden auf das fragile interpendente Weltsystem gegeben? Eine erste Antwort ist der Versuch der Wiederherstellung der nationalstaatlichen Souveränität durch Abschottung vom globalen Strukturwandel. Diese äußert sich z. B. im wirtschaftlichen Protektionismus oder in Maßnahmen zur Einschränkung der globalen Migration. Staaten versuchen den Verlust an Macht und Steuerungskapazität durch intensive Verregelungsund Institutionenbildungsprozesse zu kompensieren oder durch Abschottungen zu verlangsamen. Abschottungen fördern aber die Fragmentierung. Das Gegenteil dazu ist die marktwirtschaftliche Vorgehensweise: Der Nationalstaat stellt sich dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb durch aktive Strategien der Standortverbesserung, treibt damit den nationalstaatlichen Wettbewerb voran. Eine weitere Lösungsmöglichkeit wird in der Etablierung internationaler Organisationen gesehen: Die Weltgesellschaft wird als vergrößerter Nationalstaat betrachtet, diese ist durch eine Weltregierung, Weltparlament und Weltjudikative geordnet. Dabei wird häufig der UN eine solche zukünftige Aufgabe zugedacht – der Sicherheitsrat als Weltregierung, die Generalversammlung als Weltparlament, ein Weltstrafgerichtshof als Judikative, der IWF als Weltzentralbank, die WTO u. a. als Weltkartellamt. Da dabei das Problem der Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit von Entscheidungen entsteht, sehen manche realistisch nur ein Weltordnungssystem, welches durch eine Hegemonialmacht, z. B. den Vereinigten Staaten, hergestellt und gesichert wird. Schließlich spielt das Konzept des Global Governance („Regieren ohne Regierung“) eine wichtige Rolle für die zukünftige Bewältigung globaler Herausforderungen. Das Global Governance-Konzept beruht auf einer schlichten Erkenntnis: Wenn sich die Probleme globalisieren, muss sich auch die Politik globalisieren. Das Konzept meint nicht die Idee einer zentralen Weltregierung und auch nicht das Ende des Nationalstaats. Vielmehr will Global Governance eine multilaterale Kooperationskul tur schaffen. Damit sollen den Nationalstaaten in einer Mehr-Ebenen-Architektur dort Handlungskompetenzen zurückgegeben werden, wo sie diese durch die Globalisierungstendenzen zu verlieren drohen. Allerdings müssen sich die Nationalstaaten zunehmend mit geteilten Souveränitäten und weltweiten Kooperationsund Integrationsräumen abfinden. Global Governance geht über das Mehr an staatlich orWas bedeutet Global Governance? Global Governance – ein unscharfer Begriff, der im Deutschen meist als „weltweites Regieren“ oder „globale Struktur und Ordnungspolitik“ bezeichnet wird – stellt den Versuch dar, globale Probleme mit einem neuen politischen Ordnungsmodell zu bewältigen. Dabei sollen weltweit operierende Netzwerke verschiedener staatlicher und nichtstaatlicher Akteure zusammenwirken. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
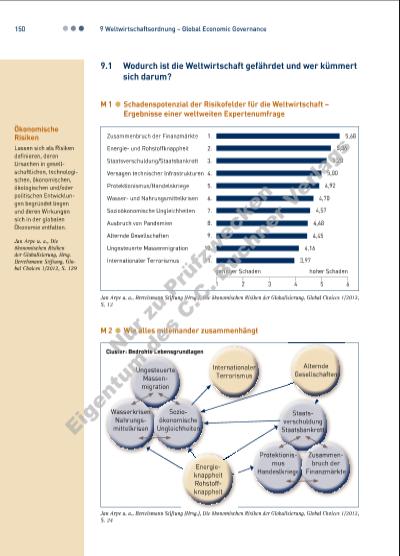 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |