| Volltext anzeigen | |
493.6 Wirtschaftswachstum – Rettung durch den starken Staat? 3.6 Wirtschaftswachstum – Rettung durch den starken Staat? M18 Mit Staatsnachfrage aus der Krise: die Keynes’sche Revolution In der keynesianischen Theorie und der auf ihr basierenden Wirtschaftspolitik steht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage [...] im Mittelpunkt. Diese ist aber zumeist höchst instabil und verläuft in Konjunkturzyklen. Dabei treten folgende typische Konstellationen auf: Während einer Rezession steigt die Arbeitslosigkeit an, während die Inlation niedrig ist und sogar noch sinkt. Umgekehrt steigt diese in Boomphasen, während dann Vollbeschäftigung herrscht. [...] Bei steigenden Einkommen sinken – nach dem „psychologischen Gesetz“ von Keynes – die Konsumausgaben, während das Sparen an Bedeutung gewinnt. Der Mensch arbeitet also nicht nur, um seine aktuellen Konsumwünsche befriedigen zu können, sondern auch, um Ersparnisse und Vermögen anzusammeln. [...] Ferner können die Investitionen der Unternehmen zu niedrig ausfallen, weil die Zinsen zu hoch sind. Dabei spielt bei Keynes die Zukunftserwartung in Bezug auf die Absatzmöglichkeiten eine entscheidende Rolle. Hat ein Unternehmer in einer Krise trotz niedriger Zinssätze „Angst“, so wird er nicht investieren, selbst wenn die Zinssätze auf Null sinken. Das Geld wird stattdessen zu Spekulationszwecken „gehortet“. Damit verlieren der Zinssatz und die Geldpolitik ihre ausgleichende Wirkung. Zusätzliches Geld verschwindet in der „Liquiditätsfalle“. Um die Wirtschaft aus einer solchen Krise herauszuführen, muss die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gesteigert werden, was zugleich die pessimistische Erwartungshaltung beendet. Dies geschieht durch eine antizyklische Fiskalpolitik – auch Globalsteuerung genannt – des Staates: Durch „deicit spending“, also durch erhöhte Staatsausgaben und Steuersenkungen, die zur Erhöhung des Konsums und der Investitionen beitragen, wird die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gesteigert. Finanziert werden soll dieses „deicit spending“ in einer Rezessionsphase durch staatliche Kreditaufnahme am Kapitalmarkt. In Zeiten des wirtschaftlichen Booms sollen dann die Staatsausgaben wieder gesenkt und die Steuern (temporär) erhöht werden [...]. Auf diese Weise soll zusätzliches Geld in die Staatskasse gelangen. Kredite können abgelöst bzw. eine Konjunkturausgleichsrücklage gebildet werden, die in der nächsten Rezessionsphase eingesetzt werden kann. Dadurch hilft die Stabilitätspolitik, so die These, „Überhitzungen“ in einer Phase der Hochkonjunktur samt dazugehörenden inlationären Tendenzen zu verhindern. Bei dieser Globalsteuerung ist es für Keynes nicht nötig, dass der Staat die gesamte Nachfragelücke mit seinem „deicit spending“ schließt. Es reicht, wenn er als Initiator fungiert, denn das durch sein Gegensteuern erzeugte neue Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage führe zu einer verstärkten Nachfrage nach Investitionsgütern, was wiederum mehr Produktion, mehr Arbeitsplätze und mehr Einkommen bewirke (der sog. „Multiplikatoreffekt“). Dieser Multiplikatoreffekt erhöhe wiederum die Konsumausgaben und kurbele die Nachfrage nach Gütern und Investitionen an. Dadurch stiegen zusätzlich Produktion und Einkommen (der sog. „Akzeleratoreffekt“). Christian Roth, Wirtschaftspolitische Strategien: Keynesianismus und Monetarismus. In: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hg.): Finanzund Wirtschaftskrise in Europa. Heft 59/2010, S. 36 f. John Maynard Keynes (1883 – 1946), britischer Ökonom und Regierungsberater, gilt als Begründer der nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 N u r zu P rü fz w e c k E ig e u m d s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |
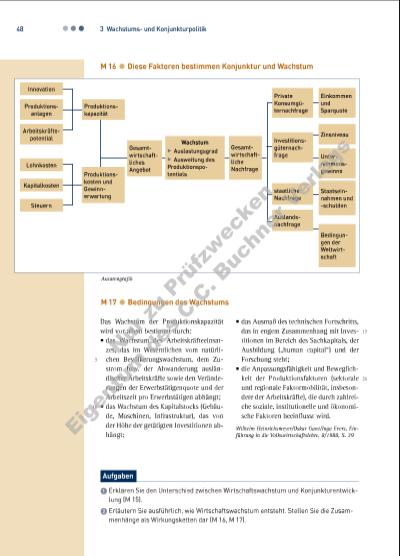 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |