| Volltext anzeigen | |
Schmuggel beizukommen. Die Kolonialparlamente protestierten. Nach ihrer Auffassung waren sie allein berechtigt, Steuern zu beschließen. Das Parlament in London, in dem kein gewählter Vertreter der Kolonisten saß, dürfe lediglich den Handel regulierende Gesetze erlassen. Erstmals machte die Forderung „No taxation without representation“ die Runde. Die Spannungen nahmen zu, als 1765 ein Einquartierungsgesetz und ein Steuermarkengesetz (Stamp Act) folgten (u M1). Mit dem Stamp Act wurden die Kolonien erstmals direkt besteuert. Alle Kaufverträge, Schuldscheine, Testamente sowie Zeitungen, Flugschriften und Spielkarten mussten mit einer Gebührenmarke bzw. einem Steuerstempel versehen werden. Das Mutterland versprach sich davon jährliche Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100 000 Pfund (heute etwa sieben Millionen Euro). Noch bevor das Gesetz in Kraft trat, trafen sich erstmals Vertreter aus neun Kolonialparlamenten im Oktober 1765 in der etwa 25 000 Einwohner zählenden Stadt New York zum Stamp Act Congress. Gemeinsam erklärten sie in ihren Petitionen an König, Oberhaus und Unterhaus, dass sie nur Steuern zahlen würden, denen sie „persönlich durch ihre Abgeordneten“ zugestimmt hätten (uM2). Die Fronten verhärten sich Es blieb nicht bei Bittschriften. Kaufl eute aus New York, Philadelphia und Boston riefen gleichzeitig zum Boykott englischer Waren auf, um die Regierung in London zu zwingen, das Gesetz zurückzunehmen. Unter dem Namen „Söhne der Freiheit“ (Sons of Liberty) entstand außerdem in New York eine grenzüberschreitende Geheimgesellschaft. Ihre Mitglieder, die aus der Mittelschicht stammten, verhinderten den Verkauf der Steuermarken und überwachten den Warenboykott. Sie schreckten dabei vor gewaltsamen Aktionen gegen britische Beamte nicht zurück. Großbritannien hatte das Nachsehen: Die Steuereinnahmen gingen bis Ende 1765 um 30 500 Pfund (heute etwa zwei Millionen Euro) zurück. Daraufhin wurde Anfang 1766 das Steuermarkengesetz aufgehoben. Das britische Parlament war aber nicht bereit, das Recht der Kolonisten auf Selbstbesteuerung anzuerkennen. Am 18. März 1766 erklärte es: „Die […] Kolonien in Amerika waren und sind rechtmäßig der Krone und dem Parlament von Großbritannien untergeordnet und von ihnen abhängig“ (Declaratory Act). Ein Jahr später wurden die Townshend-Gesetze1 verabschiedet. Sie erhoben Einfuhrzölle auf Artikel des Alltagsbedarfs wie Glas, Blei, Farben, Papier und Tee. Zudem richtete man eine zentrale Zollbehörde in der etwa 16 000 Einwohner zählenden Hafenstadt Boston ein. Die Händler und Unternehmer in den Kolonien zeigten deutlich, was sie von dem Vorgehen hielten: Sie reagierten erneut mit einem Importstopp. Der Widerstand breitete sich aus: Frauen forderten dazu auf, englische Textilien durch einheimische zu ersetzen und Tee nur noch aus einheimischen Kräutern aufzubrühen. Britische Beamte oder diejenigen, die sich nicht am Boykott beteiligten, wurden von radikalen Anhängern der „Freiheitsbewegung“ durch die Straßen gejagt, geteert und gefedert. 1 Benannt nach dem britischen Schatzkanzler Charles Townshend (1725 1767). i Teekanne aus dem Jahr 1766. Der Schriftzug ruft zur Abschaffung des Stamp Act auf. 85„American Revolution“: Ein moderner Staat entsteht 7316_1_1_2015_080-107_Krisen_Revolutionen.indd 85 05.05.15 13:00 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m de s C .C . B uc hn r V er la gs | |
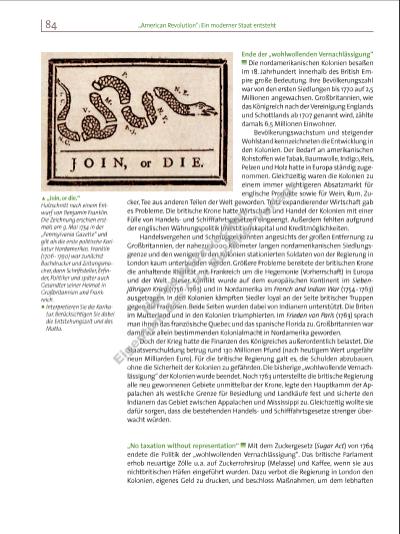 « | 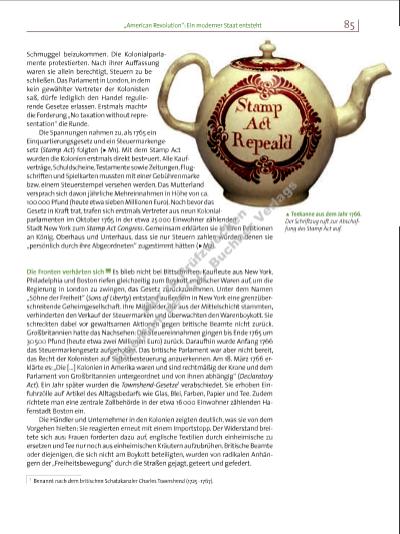 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |