| Volltext anzeigen | |
Die Quantitätsgleichung: Grundkonzeption der Geldmengensteuerung Die Grundkonzeption der Geldmengensteuerung ergibt sich aus der Quantitätsgleichung, auch Fishersche Verkehrsgleichung genannt. Sie ist der Kern inhalt der Quantitätstheorie und drückt das Verhältnis von Geldmenge und Gütermenge aus: G × U = P × H G: Geldmenge U: Umlaufgeschwindigkeit des Geldes P: Preisniveau H: Handelsvolumen Die Quantitätsgleichung drückt eine Beziehung zwischen der Entwicklung der Geldmenge und der Veränderung des Preisniveaus aus: Bleibt die Umlaufge schwindigkeit des Geldes – wie in vielen Fällen – konstant, dann ist das nomi nale Volkseinkommen, als Produkt aus Preisniveau und Handelsvolumen, funktional abhängig von der Geldmenge: P = G:H. Das Preisniveau bleibt also dann unverändert, wenn die Geldmenge nicht schneller zunimmt als das rea le Handelsvolumen. Zur Inflation kommt es, wenn die Geldmenge schneller zunimmt als das Handelsvolumen. Um also einen allgemeinen Preisauftrieb zu vermeiden, soll die Geldmenge möglichst schwankungsfrei und an den re alen Produktionsmöglichkeiten orientiert ausgeweitet werden. Dieser Zusam menhang ist die theoretische Basis des geldpolitischen Konzepts des Moneta rismus und Grundlage für die Geldmengensteuerung durch die EZB. Die geldpolitische Strategie der EZB Über die Zielsetzung der Geldpolitik wird unter Wissenschaftlern und Politi kern kontrovers diskutiert. Umstritten ist vor allem, ob die EZB ausschließ lich dem Ziel der Geldwertstabilität verpflichtet sein soll oder ob sie auch das Erreichen weiterer wirtschaftspolitischer Ziele, insbesondere einen ho hen Beschäftigungsstand, aktiv unterstützen soll. Die Diskussion wird im mer dann besonderes heftig geführt, wenn stabile Preise einhergehen mit drückender Unterbeschäftigung. Das zentrale geldpolitische Ziel der EZB ist allerdings klar vorgegeben und wird von ihr im Hinblick auf den durch eine Geldentwertung verursachten volkswirtschaftlichen Schaden konsequent verfolgt. Nach Art. 127 AEUV ist sie verpflichtet, ihr Handeln vorrangig am Erreichen der Geldwertstabilität auszurichten. Maßgröße dabei ist der Harmonisierte Verbraucherpreisindex, der einen Anstieg der Verbraucherpreise für alle beteiligten Eurostaaten in prinzipiell gleicher Weise erfasst und der jährlich um weniger als 2 Prozent ansteigen soll. Die Quantifizierung ist allerdings nicht ausdrücklich als di rektes „Inflationsziel“ zu verstehen, das bei Abweichungen automatisch zu geldpolitischen Reaktionen der EZB führen muss, auch deshalb, weil die Politik der EZB nur mit gewissen Zeitverzögerungen und auch nur indirekt über Zwischenzielgrößen greift. Und die Zwischenzielgröße, die in sehr en gem Zusammenhang mit der Inflationsrate steht und auch relativ genau Umlaufgeschwindigkeit Mit der Umlaufgeschwindig keit ist die Häufigkeit ge meint, mit der das Geld in einer Periode umgeschlagen wird. Wird ein 100Euro Schein einmal pro Wirt schaftsperiode eingesetzt, hat er eine Kaufkraft von 100 €, wechselt er fünfmal, ist seine Kaufkraft 500 €. Eine Veränderung der Umlauf geschwindigkeit wirkt wie eine Geldmengenänderung. Unter dem Handelsvolumen sind sämtliche in einer Wirtschafts periode getätigten Güter, Dienstleistungs und sons ti gen Umsätze zu verstehen. Warum gerade 2 %? Noyer: Wir haben uns ganz bewusst für die 2 % entschie den, weil bis zu diesem Wert der Inflationsrate die Bevölke rung den Eindruck stabiler Preise hat. Dementsprechend richten – ökonomisch gesehen – die Wirtschaftssub jekte ihre Handlungen an der Preisstabilität aus. Steigen die Preise um deutlich mehr als 2 %, wähnen sich die Menschen in einem inflatio nären Umfeld. Das findet dann seinen Niederschlag in höheren Lohnabschlüssen oder im Investitionsverhalten. Aller Erfahrung nach beginnt die Bevölkerung mit Teue rungsraten von mehr als 2 %, Inflation in ihre Verhaltens weisen einzuplanen. Interview mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der EZB Christian Noyer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.1.1999 632.4 Strategie und Grenzen der Geldpolitik Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C . uc hn er V er la gs | |
 « | 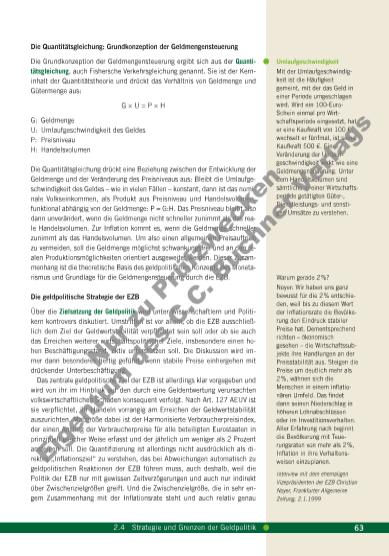 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |