| Volltext anzeigen | |
213Europa im Schatten Napoleons M2 Preußens „Revolution von oben“ In der „Rigaer Denkschrift“ vom 12. September 1807 empfi ehlt der auf Befehl Napoleons entlassene preußische Staatsminister Karl August Fürst von Hardenberg dem König von Preußen: Die Französische Revolution, wovon die gegenwärtigen Kriege die Fortsetzung sind, gab den Franzosen unter Blutvergießen und Stürmen einen ganz neuen Schwung. Alle schlafenden Kräfte wurden geweckt, das Elende und Schwache, veraltete Vorurteile und Gebrechen wurden – freilich zugleich mit manchem Guten – zerstört. […] Der Wahn, dass man der Revolution am sichersten durch Festhalten am Alten und durch strenge Verfolgung der durch solche geltend gemachten Grundsätze entgegenstreben könne, hat besonders dazu beigetragen, die Revolution zu befördern […]. Die Gewalt dieser Grundsätze ist so groß […], dass der Staat, der sie nicht annimmt, entweder seinem Untergange oder der erzwungenen Annahme derselben entgegensehen muss. […] Also eine Revolution im guten Sinn, gerade hin führend zu dem großen Zwecke der Veredelung der Menschheit, durch Weisheit der Regierung und nicht durch gewaltsame Impulsion1 von innen oder außen, – das ist unser Ziel, unser leitendes Prinzip. Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung: Dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist.2 […] Man schrecke nicht zurück [vor] Freiheit und Gleichheit. Nicht die regellose, mit Recht verschriene: die die blutigen Ungeheuer der Französischen Revolution zum Deckmantel ihrer Verbrechen brauchten […], sondern nur diese nach weisen Gesetzen eines monarchischen Staats, die die natürliche Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger nicht mehr beschränken, als es die Stufe ihrer Kultur und ihr eigenes Wohl erfordern. Zitiert nach: Walter Demel und Uwe Puschner (Hrsg.), Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongreß 1789 1815, Stuttgart 1995, S. 87 f. und 89 f. 1. Arbeiten Sie die Haltung Hardenbergs gegenüber der Französischen Revolution heraus. 2. Vergleichen Sie Napoleons Einstellung (M1) mit Hardenbergs Überlegungen (M2). M3 Über den Mythos vom „Befreiungskrieg“ Die Tübinger Historikerin Ute Planert ist in einer 2007 veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit der Wahrnehmung und Bedeutung der „Befreiungskriege“ nachgegangen und kommt zu folgendem Ergebnis: Die Vorstellung, dass sich die deutsche Nation in den Kriegen gegen Napoleon gebildet habe, lässt sich in dieser pauschalen Form nicht länger aufrechterhalten. Schon der Blick auf Preußen und die Bildungseliten macht deutlich, dass einerseits Nationalbewusstsein und antifranzösische Stereotype unter den Gebildeten bereits lange vor der Französischen Revolution verbreitet waren, andererseits die Nationalbegeisterung 1813 nicht einmal in Preußen alle Regionen, Konfessionen und Bevölkerungsschichten erfasste. Dass die Spendenund Mobilisierungsbereitschaft mit dem geografi schen Abstand zur preußischen Hauptstadt abnahm und sich in den katholischen Gebieten Schlesiens kaum Unterstützung regte, lässt deutlich erkennen, dass es in erster Linie die Loyalität zur preußischen Monarchie war, welche die Menschen zu Hilfeleistungen motivierte. Daneben spielten bei der preußischen Kriegsmobilisierung antifranzösische Affekte infolge der ökonomischen Ausbeutung und der Belastung durch die Grande Armée eine wichtige Rolle. Die bewusste Hinwendung zur deutschen Nation blieb jedoch eine Position intellektueller Minderheiten. Selbst für die meisten der rund 500 Publizisten, welche den „Befreiungskrieg“ propagandistisch abstützten, bildeten patriotischpreußische und national-deutsche Vorstellungen noch eine unentwirrbare Gemengelage. Die starke religiöse Färbung gerade derjenigen Schriften, die sich – wie Arndts Kriegskatechismus3 – an ein breites Publikum richteten, zeigt, dass zur Mobilisierung breiter Bevölkerungsschichten das nationale Argument allein nicht ausreichte. Ute Planert, Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden: Alltag – Wahrnehmung – Deutung 1792 1841, Paderborn 2007, S. 655 f. 1. Skizzieren Sie Planerts Kritik am Mythos „Befreiungskrieg“. 2. Prüfen Sie die Argumente gegen den Mythos, die deutsche Nation habe sich „in den Kriegen gegen Napoleon gebildet“ (Zeile 1 f.). 5 10 15 20 25 3 Der preußische Schriftsteller und Historiker Ernst Moritz Arndt (1769 1860) rief in seinem 1812 veröffentlichten „Kurzen Katechismus für teutsche Soldaten nebst einem Anhang von Liedern“ und seinem ein Jahr später publizierten „Katechismus für den teutschen Kriegsu. Wehrmann“ zum Kampf gegen den „Tyrannen“ Napoleon und alle seine Unterstützer auf. 1 Impulsion: Anstoß, Anregung 2 Offenbar nach Immanuel Kant, der mit Blick auf die Französische Revolution forderte: „Autokratisch herrschen und dabei doch republikanisch […] regieren, ist das, was ein Volk mit seiner Verfassung zufrieden macht.“ 5 10 15 20 25 N r z ur P rü zw ck e Ei ge nt um d s C .C . B uc hn r V rla gs | |
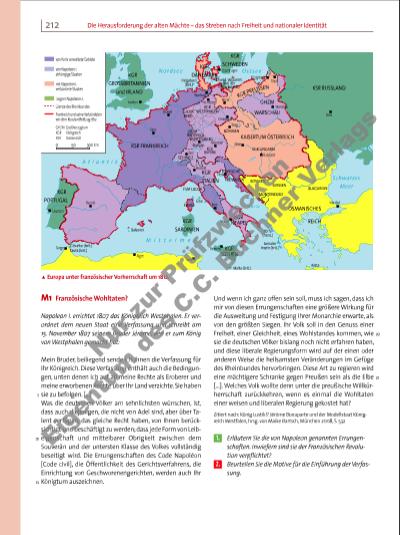 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |