| Volltext anzeigen | |
217Rezeption antiker Staatsformen in der Amerikanischen und der Französischen Revolution Geschichte der Staatsformen jedoch, auf die sich demokratische Verfassungsstaaten heute beziehen, wäre es anerkanntermaßen abwegig, nicht schon vorher in Frankreich, Schweiz und USA die Demokratie am Werk zu sehen. Sie beruhten, wie jeder weiß, schon länger auf souveränen Mehrheitsentscheidungen, was eine evolutionäre oder revolutionäre Abkehr von Monarchie und Feudalismus auch dann bleibt, wenn die Gruppe der Träger von Bürgerstatus und Partizipationsrechten zunächst beschränkt war. Während man sich darüber recht einig ist, verhält es sich mit der Bewertung der radikalen Demokratie im Athen des fünften und vierten Jahrhunderts vor Christus anders. Hier, beim Urbild aller Demokratien, werden scharfe Modernitätsansprüche gestellt. Ein gängiges Urteil lautet, eine wirkliche Demokratie könne das nicht gewesen sein, weil Frauen sowie Männer ohne Bürgerstatus (Sklaven und Zuwanderer) damals von der Volksversammlung und den Volksgerichten ausgeschlossen waren. War die uneingeschränkte Gesetzgebungsund Rechtsprechungsmacht der athenischen Menge für Demokratiephobiker1 aller Epochen ein Schreckbild, so ist man heute umgekehrt beleidigt, dass die Athener vor 2 500 Jahren noch nicht komplett grundgesetzkonform waren. „Wohl keine andere Ordnung in der Weltgeschichte“, schreibt der Historiker Wilfried Nippel, „wird mit so evident anachronistischen Maßstäben bewertet wie die athenische Demokratie.“ Und woran liegt das? „Offensichtlich hat im Bewusstsein der Nachwelt Athen mit seiner Kategorie der Demokratie eine überzeitlich geltende Norm gesetzt, an der seine eigene Praxis gemessen wird.“ Platons Verachtung der wankelmütigen Masse in der „Theatrokratie“2 seiner Vaterstadt hat in der neuzeitlichen Verfassungsund Politikgeschichte tiefe Spuren hinterlassen. […] Auf der anderen Seite aber machte Athens Demokratie, die den einfachen Bürger in einem für alle Zeiten unerhörten Ausmaß in die Politik einspannte, immer auch gewaltigen Eindruck: mit ihrer Machtentfaltung und ihrer im Ganzen beeindruckenden Stabilität, mit ihrer großen politischen Rhetorik und ihrer Kunst. Der Bürgerhumanismus im Florenz des frühen 15. Jahrhunderts appellierte an das Vorbild Athen und entwickelte erste Ansätze eines modernen Verfassungsverständnisses [...]. Die Geschichte der Beschäftigung mit Athens Direktdemokratie ist also zugleich die Geschichte der neuzeitlichen Verfassungsdiskussion und ihres Ringens um die Demokratie. […] Anders als mancher, der mehrere Jahrtausende zurückblickt, erliegt der Autor [Wilfried Nippel] nicht dem „Alles schon dagewesen“. [...] So führt Nippel in seinem gesamten ideengeschichtlichen Panorama vor, dass man den Einfl uss der Antike auf die moderne Verfassungsgebung auch nicht übertreiben darf. Gewiss, die Engländer zitierten gerne den Redner Demosthenes, und Ciceros Formel „salus populi suprema lex esto“3 hat dem „Wohlfahrtsausschuss“ des französischen Revolutionsterrors, dem „Comité de Salut public“, seinen Namen gegeben. Aber vielfach blieb das dramatische Personal des Altertums bloß rednerischer Schmuck, während Englands puritanische Revolution, sein Schritt für Schritt emanzipiertes Parlament oder unsere Kataloge von Menschenrechten sich keineswegs antiken Triebkräften verdanken. Auch strukturelle Ähnlichkeiten der Organisation beweisen noch nicht, dass überall Perikles herumspukt: Die Geschworenengerichte der Französischen Revolution folgen dem englischen, nicht dem attischen Modell. Und die alternative „Basisdemokratie“ seit den Siebzigerjahren hat etwa mit ihrem Rotationsprinzip deutliche Anklänge an das System in Athen, „ohne dass“, wie Nippel schreibt, „die Grünen im Verdacht gestanden hätten, sich mit der Antike auseinandergesetzt zu haben“. Johan Schloemann, Staatsknechtschaft des Individuums, in: Süddeutsche Zeitung vom 25. Juli 2008 1. Erläutern Sie, warum die „reine“ Demokratie in der europäischen und amerikanischen Verfassungsdiskussion kein leuchtendes Vorbild war (M1 M3). 2. Diskutieren Sie: Politische und gesellschaftliche Grundfragen (z. B. Umgang mit Asylbewerbern, Wiedereinführung der Todesstrafe, Beteiligung der Bundeswehr an Auslandseinsätzen) sollten basisdemokratisch (also durch Volksabstimmungen) entschieden werden. 3. Diskutieren Sie ausgehend von der Rezension (M3) die Argumente, die Athener Demokratie sei gar nicht demokratisch gewesen. 4. Recherchieren Sie, bei welchen US-amerikanischen Institutionen, Städtenamen, repräsentativen Gebäuden etc. antike Vorbilder Pate standen. Nutzen Sie dazu auch den Bericht über die Tagung „Konstruktion und Verargumentierung von Antike in Nordamerika, 1763 1809“ von 2009 im Internet auf der Kommunikationsplattform für Historikerinnen und Historiker H-Soz-Kult. 1 Demokratiephobiker: Menschen, die die Demokratie scheuen bzw. Angst vor ihr haben 2 Theatrokratie: Herrschaft des Theaters; Theaterstücke bestimmten das politische Urteil der Athener. 3 „Salus populi suprema lex esto“: „Das Wohl des Volkes sei höchstes Gesetz.“ Der Satz ist seit 1822 Motto des US-Staates Missouri. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Nu r z ur P rü fzw ec k Ei ge nt um d es C .C . B uc hn r V er la gs | |
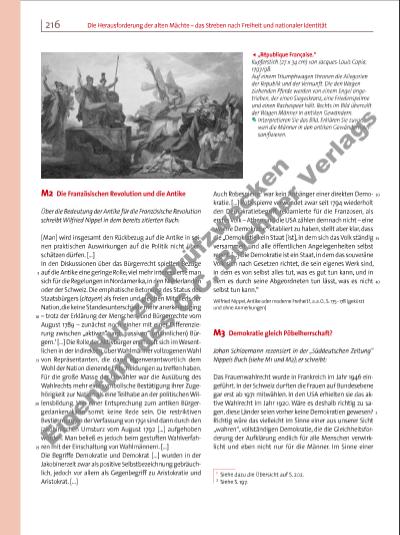 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |