| Volltext anzeigen | |
Glossar Ablass, -handel: Bestandteil der katholischen Bußlehre (u Christentum). Nachlass der Strafen für Sünden gegen bestimmte Leistungen (Geldspende, Teilnahme an einer Wallfahrt oder an einem u Kreuzzug). Voraussetzungen für den Ablass waren Reue, Beichte und Freisprechung von den Sünden (Absolution) durch einen Priester. Martin Luther kritisierte den Ablasshandel, mit dem die weltlichen und geistlichen Herren ihre Einkünfte steigerten (u Reformation). Absolutismus (lat. legibus absolutus: von den Gesetzen losgelöst): monarchische Herrschaftsform (u Monarchie) und Epochenbezeichnung für das 17. bis 19. Jh., in der Fürsten ihre Stellung von Gott (u Gottesgnadentum) und ihrer Herkunft (u Dynastie) ableiteten und versuchten, „losgelöst“ von den Gesetzen und den Ständen (u Ständewesen) zu regieren. Die absolutistischen Fürsten fühlten sich nur Gott und ihrem Gewissen verantwortlich. Kennzeichen des absolutistisch regierten Staates waren: Zentralisierung der Herrschaft, Beschränkung des Einfl usses des u Adels und der Kirche, Bürokratisierung, u Merkantilismus, Staatskirchentum, Vereinheitlichung des Rechts, ein stehendes Heer, eine expansive Außenpolitik und eine aufwändige Hofhaltung. In der politischen Realität blieb die Macht der Fürsten aber begrenzt, sie waren weiterhin auf Kompromisse und Konsens mit den Vertretern der Stände angewiesen. Adel: in der u Antike die herrschende Schicht; in der Römischen u Republik die u Patrizier. Die herausgehobene Stellung des Adels in der Gesellschaft beruhte auf Leistungen im Krieg, Herkunft aus einer besonderen Familie oder Besitz über Land und Leute. Im u Mittelalter bildete der Adel (althochdeutsch adal: Geschlecht) einen Stand der Gesellschaft (u Ständewesen). Der Adel bestand aus Familien, die aufgrund von Geburt, Besitz oder Leistung eine höhere Stellung einnahmen. Vom übrigen Volk grenzte er sich durch Vorrechte (u Privilegien), Umgangsformen und Kleidung ab. Zum niederen Adel gehörten die u Ritter und (ursprünglich unfreien) Dienstmannen (Ministerialen) der u Könige. Zum Hochadel zählten Herzöge und die Vertreter der Könige in einem Amtsbezirk, die Grafen. Die Herrscher nahmen sich das Recht, verdiente Personen in den Adelsstand zu erheben. Seit dem 14. Jh. konnte der Adelsstand durch einen Adelsbrief des u Kaisers verliehen werden: „Briefadel“ im Gegensatz zum Uradel. Im Verlauf der u Französischen Revolution wurden alle Adelsvorrechte aufgehoben. Unter Napoleon wurde dies wieder rückgängig gemacht. Ancien Régime (wörtlich: alte, frühere Regierung): Mit dem Begriff wird die feudale Herrschaftsund Gesellschaftsordnung (u Feudalismus) vor der u Französischen Revolution bezeichnet. Antike (lat. antiquus: alt): in der europäischen Geschichte die Zeit von etwa 1000 v. Chr. bis ins 5. Jh. n. Chr., in der die Griechen und Römer den Mittelmeerraum beherrschten und kulturell prägten. Aristokratie (griech. aristos: Bester; kratéin: Herrschaft = Regierung der Besten): Ordnung des Zusammenlebens seit der u Antike, in der die Abstammung von einer vornehmen Familie (u Adel, u Patrizier) Voraussetzung für die politische Macht war. Aufklärung: Epoche der Wissenschafts und Geistesgeschichte, die sich im 17. und 18. Jh. entfaltete. Die Aufklärer verließen sich bei ihrer Suche nach der Wahrheit auf Vernunft (lat. ratio), Experimente und Erfahrungen (griech. empeiria). Sie setzten sich für eine bessere Schulbildung der Menschen ein. Der bedeutendste deutsche Aufklärer war der Königsberger Philosoph Immanuel Kant. Balance of power (Gleichgewicht der Macht): Grundprinzip der englischen Außenpolitik vom 17. bis 20. Jh. Ziel war es, das machtpolitische Gleichgewicht zwischen den europäischen Staaten zu wahren bzw. die u Hegemonie einer Macht (oder eines Mächtebündnis) zu verhindern. Bischof (griech. episkopos: Aufseher): Gemeindevorsteher. Er überwachte die Einhaltung der Glaubenslehre, weihte die Priester und durfte über Angehörige der Kirche richten. Sie kamen meist aus dem hohen u Adel. Eine besondere Stellung übernahm der Bischof von Rom, der u Papst. Bürger: im u Mittelalter alle freien Bewohner einer Stadt, die das Bürgerrecht besaßen und damit am politischen Leben der Stadt teilnehmen durften. Das Bürgerrecht war im Mittelalter erblich. Es beruhte auf städtischem Grundbesitz. Kein Bürgerrecht hatten Gesellen, Gesinde, Arme und Juden (u Judentum) (seit dem 12./13. Jh.). Heute sind Bürger alle Mitglieder eines Staates. Bürgertum: Vom u Mittelalter bis Ende des 18. Jh. bildete dieser Bevölkerungsteil den dritten Stand der Gesellschaft (u Ständewesen); zu ihm gehörten freie Bauern und u Bürger. In der u Französischen Revolution erstritt sich das Bürgertum seine rechtliche und politische Gleichberechtigung mit dem Klerus (erster Stand) und dem u Adel (zweiter Stand). Calvinismus: Lehre des Genfer Reformators Jean Calvin; seine strenge Lehre war die Grundlage für eine reformierte Gottesdienstordnung. Calvin ging von der Vorherbestimmung (Prädestination) der Menschen aus. Gott allein bestimme 223Glossar Nu r z ur P rü fzw ck en Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V rla gs | |
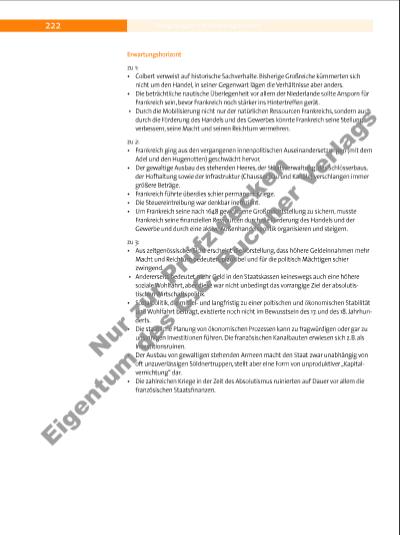 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |