| Volltext anzeigen | |
gegen die absolutistische Regierungsweise (u Absolutismus) richtete. Demnach sind die Hauptaufgaben eines Staates von drei getrennten Einrichtungen zu erfüllen, die sich gegenseitig kontrollieren: Das Parlament (Legislative) beschließt Gesetze, die Regierung (Exekutive) führt sie aus und die unabhängigen Gerichte (Judikative) sprechen Recht. Die u Virginia Bill of Rights von 1776, die amerikanische Bundesverfassung von 1787 und die französische Verfassung von 1791 (u konstitutionelle Monarchie) berücksichtigten erstmals die Gewaltenteilung. Ghetto: städtischer Wohnbezirk der Juden (u Judentum); ursprünglich auf deren Wunsch zum Schutz ihrer Ansiedlung errichtet, seit dem Spätmittelalter (u Mittelalter) Zwangsmaßnahme zur räumlichen Trennung von Juden und Christen (u Christentum). Gleichgewichtspolitik u Balance of power Glorreiche Revolution: In England scheiterte das Streben der u Könige nach einer absolutistischen Herrschaft (u Absolutismus) am Widerstand des u Parlaments, das seit dem 14. Jh. bestand. Nach der Hinrichtung König Karls I. 1649 entstand für kurze Zeit eine u Republik. Am Ende der unblutigen u Revolution von 1688/89, der „Glorious Revolution“, legte 1689 die „Bill of Rights“ Rechte und Pfl ichten des Parlaments und der Könige fest. Sie machte England zur u konstitutionellen Monarchie. „Goldene Bulle“: Dieses Reichsgesetz von 1356, dessen Siegel in einer goldenen Kapsel („Bulle“) aufbewahrt wurde, legte das Verfahren für die Wahl des u Königs und u Kaisers des u Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation fest. König sollte derjenige sein, der bei der Wahl die meisten Stimmen der sieben u Kurfürsten erhielt. Die „Goldene Bulle“ war als „Reichsgrundgesetz“ ein wichtiger Teil der Verfassung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bis zu dessen Ende 1806. Gottesgnadentum: Rechtfertigung (u Legitimation) der erblichen Herrschaft eines Monarchen (u Monarchie) als direkt von Gott verliehen (u Absolutismus). Grundherrschaft: Herrschaft über Land und Leute. Die Grundherren übergaben Teile ihres Landbesitzes an Bauern (u Leibeigene) zur Bewirtschaftung. Diese mussten ihnen dafür einen Teil der Erträge abliefern und Dienste leisten (u Lehnswesen). Die Grundherren gewährten den Bauern Schutz und Hilfe und durften über sie bei einfachen Straftaten richten. Die größten Grundherren in der Epoche des u Feudalismus waren die u Könige, der u Adel und die Kirche. Grundrechte u Menschenund Bürgerrechte Hanse: zunächst eine Gemeinschaft von Kaufl euten im Ostund Nordseeraum. Unter Führung Lübecks entstand um die Mitte des 13. Jh. ein Bund von freien Hansestädten, der bis zum 15. Jh. im Ostseeraum den Handel beherrschte und zugleich stärkste politische Macht war. Hegemonie (griech. hegemonia: Oberbefehl): Bemühungen eines Herrschers oder eines Staates um die Vorherrschaft in einem Bündnis oder einem Gebiet. Seit dem 17. Jh. bemühte sich beispielsweise Frankreich um eine Vorherrschaft auf dem Kontinent. England setzte dagegen in Europa auf ein „Gleichgewicht der Macht“ (u Balance of power), um seine Vorherrschaft auf den Weltmeeren zu sichern. Heiliges Land: religiöse Bezeichnung für das historische Land Israel. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation: seit 1512 gebräuchliche Gesamtformel für den Herrschaftsbereich des von den u Kurfürsten (seit 1356 sieben, ab 1648 acht) gewählten römisch-deutschen u Kaisers und der in ihm verbundenen Reichsterritorien (u Territorialstaaten). Das Heilige Römische Reich wurde trotz Kaiser nie zentral regiert. Es zerfi el mit der von Napoleon veranlassten u Säkularisation und u Mediatisierung (1803) sowie durch die Gründung des u Rheinbundes 1806. Hugenotten: Anhänger der reformatorischen Lehre in Frankreich, deren Glaube stark von der Lehre Jean Calvins (u Calvinismus) geprägt war. Sie wurden in Frankreich von Anfang an unterdrückt; 1685 erreichte die Verfolgung einen Höhepunkt und löste eine große Fluchtwelle in protestantische Gebiete Europas, nach Amerika und Südafrika aus. Humanismus (lat. humanitas: Menschlichkeit): Denkweise, die ab dem 14. Jh. dazu beitrug, dass sich das Wissen über Grammatik, Sprache, u Geschichte, Dichtkunst und Morallehre änderte. Die antike Wissenschaft und Kunst (u Antike) waren für Humanisten Ausgangspunkt ihrer Lehren. Der Humanismus prägte die Kunst und Kultur der u Renaissance. Ideologie: Vorstellung, die die Welt aus einer bestimmten Sicht erklärt und dazu auffordert, nach ihren Ideen zu handeln. Imperium Romanum (lat. imperare: befehlen): das Weltreich der Römer; Gebiete unter römischer Herrschaft. Investitur, -streit (lat. investire: bekleiden): u Kaiser und u Päpste stritten sich im 11./12. Jh. darüber, wer die u Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen in ihre Besitzrechte und geistlichen Aufgaben einsetzen durfte. Der Investiturstreit war ein Machtkampf um die u Reichskirche. Er endete im u Heiligen Römischen Reich mit einem Vertrag zwischen Kirche und Herrscher: dem „Wormser Konkordat“ 225Glossar Nu r z ur P rü fzw ck en Ei ge nt um d es C .C . B uc h er V er la gs | |
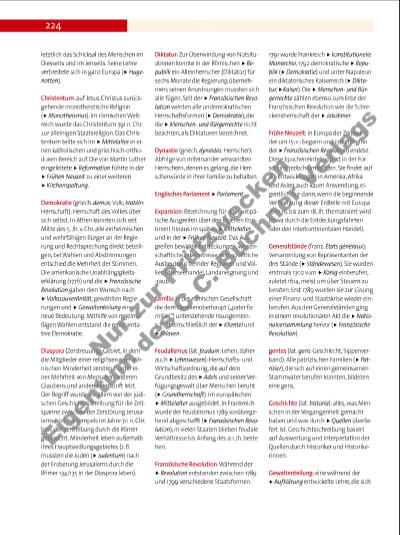 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |