| Volltext anzeigen | |
34 2 Die europäische Integration – eine Erfolgsgeschichte? O R IE N TI E R U N G S W IS S E N Nach 1945 wuchs in Europa die Überzeugung, dass eine europäische Zusammenarbeit v. a. der zwei großen Rivalen, Deutschland und Frankreich, in den Bereichen Kohle und Stahl die Grundlage für Frieden und Sicherheit auf dem Kontinent bilden könnte. Die grundlegenden gemeinsamen Werte – Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit – werden jedoch erst in der EU-Grundrechtecharta ausformuliert, die 2009 rechtskräftig wird. In der Diskussion um die Außengrenzen und die Erweiterungsfähigkeit setzt sich die Debatte um eine europäische Identität fort. Der Schuman-Plan mündete 1951 in die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, mit Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg). In den Römischen Verträgen von 1957 wurden die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft gegründet, alle drei fusionierten 1965 zur Europäischen Gemeinschaft (EG). 1971 kam das Ziel der Errichtung einer Wirtschaftsund Währungsunion hinzu. Trotz zahlreicher Beitritte in den 1970er und 1980er Jahren und der ersten Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) 1979, kam der Integrationsund Vertiefungsprozess ins Stocken: Erst 1986 wurde die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes bis 1992 konkret geplant. Der Mauerfall und der Zusammenbruch des Ostblocks beschleunigten diese Entwicklung, der Vertrag von Maastricht (1992) stellte das EG-Projekt auf drei neue EU-Säulen. Viele mittelund osteuropäische Staaten strebten eine Mitgliedschaft in dieser neuen EU an. Mit dem Abkommen von Schengen (gemeinsame Binnengrenzen, 1995) entstand ein gemeinsamer Zollund Grenzraum, in Amsterdam wurde 1997 der Stabilitätsund Wachstumspakt verabschiedet und in Nizza (2000) die Osterweiterung der EU vorbereitet. Die Wirtschaftsund Währungsunion (EWWU) wurde 2002 mit der Einführung des Euro-Bargeldes verwirklicht. 2004 und 2007 traten insgesamt zwölf vorwiegend osteuropäische Länder der EU bei. Die politische Union konnte nicht in gleichem Maße Fortschritte erzielen: 2003 sollte der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents diese vorantreiben, 2005 lehnten aber mehrere Mitgliedstaaten die Europäische Verfassung ab. Einige Reformen und Grundideen fanden Einzug in den 2009 ratifizierten Reformvertrag von Lissabon. Bedenken der Bevölkerung, die bei der Osterweiterung gehegt wurden, haben sich zwar nicht bewahrheitet, aber der Zielund Wertekonflikt der Union bleibt virulent: Der Vertrag von Lissabon verhinderte eine völlige Stagnation des Integrationsprozesses, die Diskussion über die politische, ökonomische und fiskalische Finalität der EU muss aber weitergeführt werden. In erster Linie stellt seit 2010 die EuroKrise die Solidarität in der Union auf die Probe, ein Rückfall in eine politische Zollunion kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Offen ist, ob die Staaten in dieser Situation gewillt sind, mehr Souveränitätsrechte an Brüssel abzugeben und den Weg zu einem Bundesstaat einzuschlagen. Motive und Grundlagen für eine Gemeinschaft Kap. 2.1 M 2, M 7, M 9 Die Etappen der europäischen Integration Kap. 2.2 M 4, M 6 Problemfelder des EU-Integra tionsprozesses Nu r z u Pr üf zw ec e Ei g nt um d es C .C . B uc hn r V er la gs | |
 « | 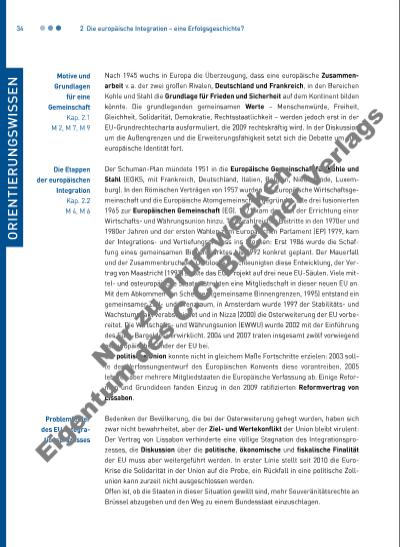 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |