| Volltext anzeigen | |
167Vertreibungserfahrungen: Frauen und Kinder sie schützen wollten, indem sie das Vorrücken der Fronten verschwiegen. Kinder wurden häufi g vom Aufbruch der Flüchtlingstrecks überrumpelt, konnten sich die Ereignisse der Flucht kaum erklären und nicht in ihr kindliches Weltbild einfügen. Die Strapazen der wochenund monatelangen Flucht in der extremen Kälte des Winters 1944/45, als im Osten zwischen Dezember und Februar Temperaturen von minus 20 Grad herrschten, Gewalterfahrungen und Todesangst mussten um so tief greifender wirken. Unerwartet und unvorbereitet Zeugen der Gewalt des Krieges, der Kämpfe, der Plünderungen der Häuser, Dörfer und Städte, der Verwüstungen, von Tod und Vergewaltigungen zu werden, bedeuteten einen krassen Einschnitt im Leben der Kinder. Flucht und Vertreibung brachte für viele von ihnen einen Abschied von der Kindheit mit sich (u M3). Häufi g ist in den Erlebnisberichten von Zeitzeugen vom frühen Erwachsenwerden die Rede. Findelkinder und „Wolfskinder“ Viele Kinder mussten wesentlich mehr Eigenverantwortung und Aufgaben für andere übernehmen als vor der Flucht und der Vertreibung. Sie mussten mithelfen, schweres Gepäck zu tragen, kleinere Geschwister zu versorgen und wurden Teil des Überlebenskampfes der Familien. Ihre Ängste und Bedürfnisse blieben häufi g unbeachtet, kaum jemand nahm noch Rücksicht auf sie und ihre besonderen Bedürfnisse. Vielen Erwachsenen galten sie nun als Konkurrenten um knappe Güter und Rettungsmöglichkeiten. Schätzungen gehen davon aus, dass Hunderttausende Kinder von ihren Müttern getrennt wurden und sich ein Wiedersehen erst nach Wochen, Monaten und zum Teil Jahren ergab. Dem 1945 eingerichteten Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes zufolge war unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg jeder vierte Deutsche auf der Suche nach Eltern, Ehepartnern, Kindern und Menschen aus der engeren Verwandtschaft. Die Karteien des Suchdienstes umfassten allein 33 000 Findelkinder aus dem Kontext von Flucht und Vertreibung, über die keine Identitätsangaben vorlagen. Vor allem in Ostpreußen blieb eine große Zahl Kinder in der Situation der überstürzten Flucht allein zurück. Um der besseren Versorgungslage willen und um Sicherheit zu fi nden, schlugen sich rund 5 000 dieser Waisen allein oder in kleinen Gruppen nach Osten, insbesondere nach Litauen, durch. Litauische Familien nahmen diese sogenannten „Wolfskinder“ auf, manche verdingten sich als Arbeitskräfte auf Bauernhöfen oder versuchten, durch Betteln zu überleben. Manche blieben auf Dauer in Litauen, viele kamen nach Jahren und Jahrzehnten in den Westen. Auch für sie gilt: Flucht und Vertreibung veränderten die betroffenen Familien grundlegend und prägten zum Teil den Alltag über lange Zeit. u Ankunft in Westdeutschland. Foto vom August 1948. Diese Kinder sind soeben mit einem Transport aus den ehemaligen deutschen Gebieten in Polen gekommen. p Charakterisieren Sie die beabsichtigte Wirkung des Fotos. Lesetipps p Stefan Aust und Stephan Burgdorff (Hrsg.), Die Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, München 2005 p Silke Satjukow (Hrsg.), Kinder von Flucht und Vertreibung, Erfurt 22010 32017_1_1_2016_Kap2_138-203.indd 167 04.05.16 10:39 Nu r z u P üf zw ec k n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |
 « | 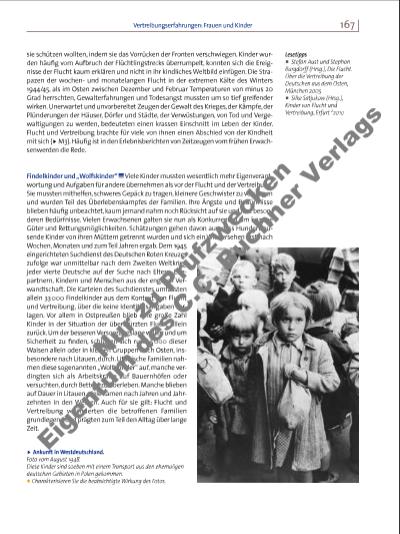 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |