| Volltext anzeigen | |
173„Verschiebebahnhof“ Europa: Kriegsfolgewanderungen Als wesentlich umfänglicher erwiesen sich die Bewegungen innerhalb des Territoriums. Innerhalb sehr kurzer Zeit siedelten sich 1,8 Millionen Tschechen und Slowaken im Sudetenland an, dessen deutsche Bevölkerung gerade vertrieben worden war. Zunächst kamen Tschechen und Slowaken aus eigenem Antrieb in die Sudetengebiete. Bereits im Herbst 1945 aber organisierte der tschechoslowakische Staat die Ansiedlung, lenkte die Bewegungen und die Verteilung des riesigen Besitzes an landwirtschaftlichem Boden, an Häusern und an anderen beweglichen und unbeweglichen Gütern, die die vertriebenen Deutschen hatten hinterlassen müssen. Die mit den Umsiedlungen und mit der Nutzung dieser Güter verbundenen Hoffnungen erfüllten sich bei Weitem nicht immer. So gab es zwar manche Tschechen und Slowaken, die als Landarbeitskräfte oder landwirtschaftliche Kleinbesitzer über genügend Erfahrungen verfügten, um die ehemals sudetendeutschen Bauernhöfe übernehmen und erfolgreich bewirtschaften zu können. Viele der Zuwanderer aber kamen nicht aus der Landwirtschaft, ihnen fehlten folglich die nötigen Qualifi kationen. Die Möglichkeiten, Einfl uss auf ihre wirtschaftliche Zukunft zu nehmen, waren nicht selten gering, weil sie sich mit dem Landbesitz zufrieden geben mussten, der ihnen zugeteilt worden war. In vielen Fällen gaben die Neusiedler die Bauernstellen wieder auf und gingen als Industriearbeitskräfte oder Handwerker in die Städte. Dennoch erhöhte sich die Bevölkerung in den ehemals von Sudetendeutschen besiedelten Gebieten rasch wieder. Das lag nicht nur an der starken Zuwanderung, sondern auch daran, dass die Neuzuwanderer in der Regel jung waren, rasch heirateten und die Geburtenraten überdurchschnittlich hoch waren. Ethnische Homogenisierung Die ausgesprochen umfangreichen Fluchtbewegungen, Vertreibungen und Umsiedlungen veränderten die Bevölkerungszusammensetzung im Osten Europas erheblich. Im Ergebnis näherte sich der Grad an ethnischer Homogenität der Bevölkerungen in vielen Staaten Ostmittelund Südosteuropas den Vorstellungen der Planer an (u M5). Minderheiten hatten nunmehr ein bei Weitem geringeres Gewicht: Während im Polen der Zwischenkriegszeit rund ein Drittel der Bevölkerung zu den Minderheiten gezählt hatte, waren es nach dem Abschluss von Fluchtbewegungen, Vertreibungen und Umsiedlungen Anfang der 1950er-Jahren nur noch drei Prozent. Ähnliches galt für die Tschechoslowakei, wo ebenfalls ein Drittel der Vorkriegsbevölkerung aus Minderheiten bestanden hatte und nunmehr nur noch 15 Prozent dazu zählten, oder in Rumänien, wo sich der Minderheitenanteil von 28 auf zwölf Prozent verringerte. 32017_1_1_2016_Kap2_138-203.indd 173 04.05.16 10:39 Nu zu P rü fzw ec k n Ei ge nt um d e C .C . B uc hn er V er la gs | |
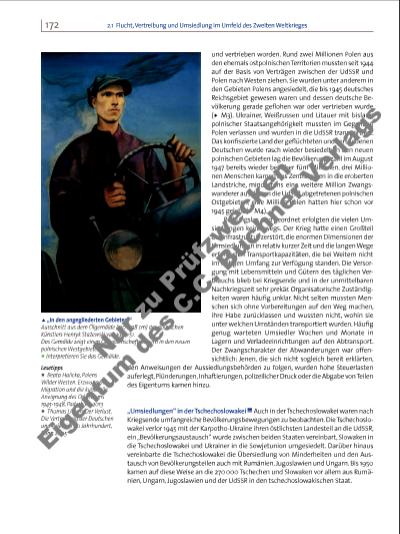 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |