| Volltext anzeigen | |
Die Interpretation eines literarischen Textes liegt nicht nur im Suchen und Nachweisen typischer formaler Kennzeichen der Textsorte. Dennoch kann es hilfreich sein, einige gängige Merkmale der Textsorten zu kennen. Unterscheide Kalendergeschichten, Anekdoten und Kurzgeschichten Die folgenden erzählenden Textsorten unterscheiden sich durch ihren Aufbau und ihre Absicht. Auch der Ort ihrer Veröffentlichung kann zur Unterscheidung beitragen. Kalendergeschichten sind kurze Erzähltexte, die ursprünglich auf den Seiten von Kalendern veröffentlicht wurden. Meist handelt es sich um anekdotenhafte Erzählungen, die den Leser unterhalten wollten oder ihm auf abwechslungsreiche Art eine Lebensweisheit vermitteln wollten. • Bekannte Autoren dieser unterhaltenden und belehrenden Texte sind etwa Johann Peter Hebel (1760–1826) oder Bertolt Brecht (1898–1956). • Kalendergeschichten sind in einer einfachen Sprache verfasst und folgen in der Regel einem unkomplizierten Handlungsverlauf. Sie richteten sich ursprünglich an ein einfaches Lesepublikum. Anekdoten sind kurze, meist unterhaltsame, witzige Geschichten über erstaunliche Ereignisse, bemerkenswerte Aussprüche oder das komische Verhalten einer meist bekannten Persönlichkeit am Rande ihres öffentlichen Lebens. • Oft endet die Anekdote mit einer überraschenden Pointe, beispielsweise einer schlagfertigen, verblüffenden oder auch bloßstellenden Äußerung oder Handlung. • Ziel der Anekdote ist allerdings nicht, sich auf Kosten der dargestellten Person zu unterhalten, sondern sie mit wenigen Sätzen so zu charakterisieren, dass man daraus Schlüsse über sich selbst und am besten auch gleich über allgemein menschliche Verhaltensweisen ziehen kann. Kurzgeschichten (amerikanisch: short story) beschreiben vielfach alltägliche Gegebenheiten. Häufig müssen die Betroffenen schwierige oder ungewohnte Situationen meistern. Nicht selten wird dabei Kritik an der Gesellschaft als Ganzes geübt. Merkmale der Kurzgeschichte sind • der sofortige Einstieg in die Handlung (kaum oder keine Einleitung), • das in der Regel offene Ende, • die meist geradlinige Erzählung (es gibt keine Nebenhandlungen), • die einfache, verständliche Sprache, • die geringe Anzahl von Figuren, • der Verzicht auf die ausführliche Beschreibung des Ortes und der Zeit, • der überraschende Wendepunkt (Pointe) am Ende der Geschichte, • die Kürze der Erzählung. Parabeln erzählen – wie Fabeln oder Gleichnisse – eine Handlung bildhaft, also in einem übertragenen Sinn. Als Zuhörer oder Leser des Textes kannst du herausfinden, wofür die einzelnen Elemente der Erzählung stehen. Der Parabeltext selbst bildet dabei die Bildebene. Das, was eigentlich gemeint ist, wird als Sachebene bezeichnet. Parabeln werden erzählt, um schwierige Inhalte leichter verständlich zu machen oder um den Erzähler vor der Reaktion des Zuhörers oder Lesers zu schützen. Literarische Textsorten u nterscheiden ➞ S. 72 ff . Literarische Texte lesen, verstehen und interpretieren 245 Texte le sen und Me dien nutzen 11077_1_1_2016_234_272_Anhang.indd 245 26.08.16 11:25 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um es C .C .B uc hn er V er la gs | |
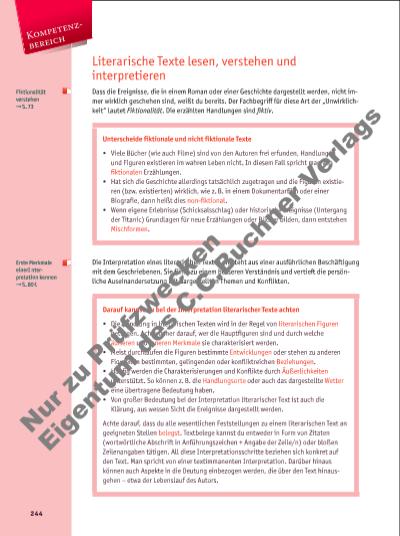 « | 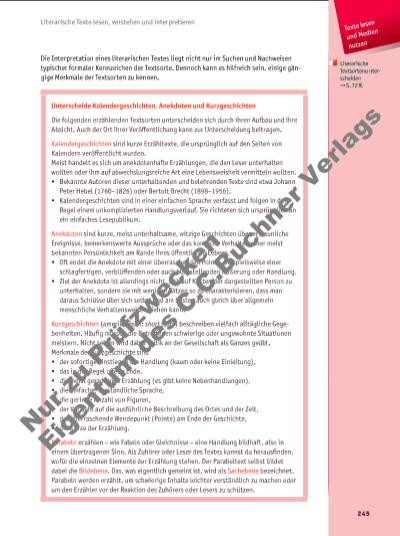 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |