| Volltext anzeigen | |
Philipp Melanchthon (1497 1560): humanistischer Philologe, Theologe, neulateinischer Dichter und Reformator. Er wurde 1518 als Professor des Griechischen nach Wittenberg berufen und organisierte während der Reformation das Unterrichtswesen. Neben Martin Luther war er eine treibende Kraft der Reformation und wurde auch „Lehrer Deutschlands“ („Praeceptor Germaniae“) genannt. Ulrich (Huldrych) Zwingli (1484 1531): Schweizer Reformator. Ihm und dem von ihm beeinfl ussten Genfer Reformator Jean Calvin (vgl. Seite 109) ging es vor allem um die Einheit von Kirchenund Bürgergemeinde. Anders als Luther verwarfen sie die „leibliche Gegenwart“ Christi im Abendmahl und akzeptierten in der Kirche nur das, was ausdrücklich in der Bibel stand. Luther lehnte die Vorstellungen der Zwing lianer und Calvinisten ab. Thomas Müntzer (1486/90 1525): Pfarrer, Theologe und Revolutionär in der Zeit des Bauernkrieges. Müntzer widersprach Luther und wollte Gottes Reich schon auf Erden verwirklichen. Er rief zum Kampf gegen die Gottlosen und die Obrigkeit auf. 1525 wurde er hingerichtet. Luther und die Auffächerung der evangelischen Bewegung Die Gemeindereformation berief sich auf Luther. Von Anfang an jedoch hatte die evangelische Bewegung viele Führer, teils Mitstreiter mit selbstständigen Vorstellungen, teils Gegner Luthers. Die evangelische Bewegung fächerte so in un gezählte Richtungen auf. Philipp Melanchthon etwa, der das evangelische Kirchenund Schulwesen ordnete, war ein enger Vertrauter Luthers, aber doch nicht völlig auf seiner Linie. Ulrich Zwingli hingegen, der für die Schweiz maßgebend wurde, rückte entschieden weiter von der alten Kirche ab als Luther. Der Thüringer Thomas Müntzer schließlich glaubte, auf biblischer Grundlage eine völlig neue Gesellschaftsordnung aufbauen zu können. Er wollte zum Entsetzen Luthers einen christlichen Gottesstaat errichten und jede weltliche Obrigkeit abschaffen. Reich und Reformation Die römisch-katholische Kirche missbilligte Luthers Lehre und forderte ihn auf, sie zu widerrufen. Aber Luther weigerte sich und brach öffentlich mit der Kirche. Daraufhin verhängte der Papst den Bann über ihn. Der erst 19 Jahre alte, seit 1519 regierende Kaiser Karl V. wollte die Einheit der katholischen Kirche erhalten. Die höchsten Obrigkeiten im Reich, Kaiser Karl V. und die Fürsten, luden Luther im Jahr 1521 vor ihren Wormser Reichstag. Der Reformator blieb sich jedoch treu und verweigerte den geforderten Widerruf. Im Gegenzug verhängte der Kaiser im Wormser Edikt die Reichsacht über ihn und seine Anhänger (u M2). Wer geächtet war, war vogelfrei, also rechtlos. Jeder durfte ihm strafl os Gewalt antun. Es war Luthers Glück, dass sein Landesherr, Kurfürst Friedrich der Weise, ihn auf der Wartburg in Sicherheit brachte und damit ihn und seine Lehre schützte. Jedoch konnte der Reformator Kursachsen nicht verlassen. Die Vollstreckung der Reichsacht oblag allerdings nicht dem Kaiser, sondern den Fürsten, weil nur sie in den Territorien des Reiches regierten. Einige vollstreckten das Edikt nicht, sodass der Reichstag 1526 den Vollzug des Ediktes überhaupt aussetzte. Drei Jahre später beschloss der Reichstag jedoch mit den Stimmen der katholischen Fürstenmehrheit, dass es wieder gelten sollte. Der Grund war, dass nach 1526 in Sachsen und Hessen eine evangelische Kirchenorganisation entstand. Die nun evangelischen Pfarrer, Diener und Lehrer wurden aus den eingezogenen Kirchengütern fi nanziert. Die vormaligen Eigentümer mussten den Verlust hinnehmen, darunter Erzbischöfe und Bischöfe, die selbst Fürsten des Reiches waren. Sie waren es, die seit 1529 den Vollzug des Wormser Ediktes und damit die Ächtung aller Evangelischen forderten. Die Macht, dies durchzusetzen, hatte nur der Kaiser, der aber seit 1521 nicht mehr im Reich weilte. Als König und Fürst in Spanien, (Süd-)Italien und den Niederlanden hatte Karl V. es mit zwei großen Gegnern zu tun. Der erste war König Franz I. von Frankreich, der Ansprüche auf italienische Besitzungen Karls erhob und sie seit 1521, wenngleich vergebens, zu erobern suchte. Der zweite Gegner war der Sultan des türkischen Osmanischen Reiches, Suleiman I. Er attackierte mit gewaltigen Flotten Inseln und Küsten des Mittelmeeres. Zugleich eroberten die Türken Südosteuropa bis weit nach Ungarn hinein und bedrohten sogar Österreich und das Reich in immer neuen Kriegen. Im Jahr 1530 kehrte Karl V. endlich nach Jahren der Abwesenheit ins Reich zurück. Er wollte und konnte die immer zahlreicheren evangelischen Fürsten und Städte nicht mit Gewalt in die Schranken weisen. Noch hoffte er auf die freiwillige Rückkehr der evangelischen Fürsten zur alten Kirche. Aber diese beharrten beim Augsburger Reichstag 1530 auf ihrem Glauben, nicht anders als Luther 1521. Der Kaiser verlangte eine Bekenntnisschrift, die einheitlich die evangelischen Glaubenssätze defi nierte, um anschließend darüber zu verhandeln. Das Resultat war das „Augsburger Bekenntnis“ Karl V. (1500 1558): König (ab 1519) und Kaiser (ab 1530) des Heiligen Römischen Reiches aus dem Geschlecht der Habsburger. Er herrschte über große, weit über Europa und Südamerika verstreute Gebiete. Karl V. versuchte vergeblich, die religiöse Einheit des Reiches zu bewahren. 1556 dankte er als Kaiser ab. 107 Reformation, Konfessionalisierung und Staatsbildung Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d s C .C .B u hn er V e la gs | |
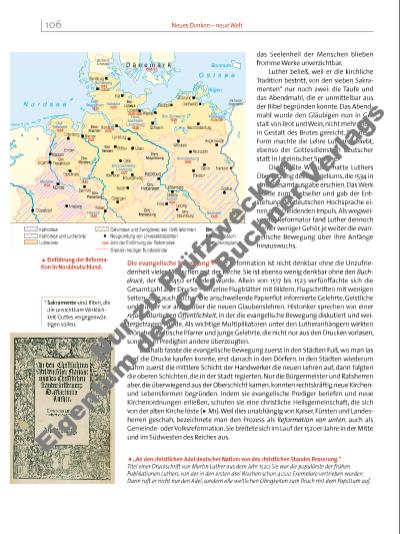 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |