| Volltext anzeigen | |
mus, die umfassende Herrschaftsgewalt des Fürsten und sein Gesetzgebungsmonopol, begründen. Hobbes betrachtete die Überantwortung der Freiheitsrechte des Einzelnen an den Herrscher als ein Instrument, das den Kampf aller gegen alle zu unterbinden vermochte und jedem den ihm zustehenden Spielraum zuteilte. Ebenso konsequent dem Vernunftdenken verpfl ichtet war die Vorstellung von der Entstehung politischer Gemeinwesen als freiwilliger Zusammenschluss von Individuen, von „Hausvätern“. In ihnen erkannte sich das Bürgertum wieder, dem die relativ starre Sozialstruktur der ständischen Gesellschaft wenig Raum für gesellschaftlichen Aufstieg und politische Einfl ussnahme ließ. Freier Erwerb und Sicherung von Eigentum bei Entfaltung aller seiner Fähigkeiten – so stellte sich das bürgerliche Denken den Zweck des Gesellschaftsvertrages vor. John Locke – Gesellschaftsvertrag und Widerstandsrecht Der Engländer John Locke veröffentlichte 1690 anonym sein Werk „Two Treatises of Government“ (u M2). In der tagespolitischen Diskussion in England nach der Glorious Revolution sollte es den Standpunkt der göttlich legitimierten absoluten Monarchie widerlegen und die Position des Parlaments stärken. Wie bei Hobbes formiert sich das Gemeinwesen nach Locke zum Schutz von Leben und Eigentum durch den Gesellschaftsvertrag. Doch bei ihm ist neben der ausführenden (exekutiven) die gesetzgebende (legislative) Gewalt oberste Gewalt im Staat. Diesen Gewalten sind durch das natürliche Recht jedes Menschen auf Freiheit seiner Person und Unversehrtheit seines Eigentums Schranken gesetzt. Ausdrücklicher Bestandteil des Zusammenlebens ist das Mehrheitsprinzip, dem sich jeder fügen müsse. Werden diese Schranken durchbrochen, hat die Gemeinschaft das Recht, die Gewalten abzusetzen. Locke formulierte also eine Art Grundrechtegarantie und leitete aus ihr ein Widerstandsrecht ab. Montesquieu – die Teilung der Staatsgewalt Der Franzose Charles de Montesquieu informierte sich eingehend über die englische Regierungspraxis. Seine Erfahrungen legte er seinem 1748 erschienenen Werk „De l’esprit des loix“ zugrunde (u M3). Unter dem „Geist“ der Gesetze verstand Montesquieu die gemeinschaftliche Mentalität eines Volkes oder einer Nation, welche von Umweltfaktoren wie Landesnatur, Klima und sozialen Faktoren wie Sitten, Religion, Stellung der Frau etc. geprägt ist und auf die Gesetze einwirkt. Die Gesetze eines Landes müssen also der Mentalität eines Volkes angepasst sein. Übergreifendes Ideal der Gesetzgebung ist die politische Freiheit. Mit Blick auf England, wo Freiheit als Verfassungszweck galt, und in freier Weiterführung von Locke entwickelte Montesquieu das Postulat der Gewaltenteilung. Die drei im Staat bestehenden fundamentalen Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative sind auf drei unabhängig voneinander handelnde Träger zu verteilen. Nur diese Trennung verhindere missbräuchliche Machtausübung. Als Angehöriger des französischen Hochadels blieb Montesquieu den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Volkes gegenüber misstrauisch. Seine Beteiligung an der Legislative hielt er zwar für richtig, jedoch nur in Form eines Repräsentativsystems, d. h. durch Abgeordnete. Gemeinsam mit Locke formulierte Montesquieu damit die Grundsätze des modernen Verfassungsstaates. John Locke (1632 1704): englischer Wissenschaftler und Staatsmann. Er lehrte in Oxford und verfasste naturwissenschaftliche, medizinische, philosophische und politische Schriften. Glorious Revolution: In England scheiterte das Streben der Könige nach einer absolutistischen Herrschaft am Widerstand des Parlaments, das seit dem 14. Jh. bestand. Nach der Hinrichtung König Karls I. 1649 entstand für kurze Zeit eine Republik. Am Ende der unblutigen Revolution von 1688/89, der „Glorious Revolution“, legte 1689 die „Bill of Rights“ Rechte und Pfl ichten des Parlaments und der Könige fest. Sie machte England zur konstitutionellen Monarchie (vgl. Seite 137). Charles(-Louis Baron de Secondat) de Montesquieu (1689 1755): französischer Rechtsgelehrter und Schriftsteller. Sein Werk „Vom Geist der Gesetze“ zählt zu den wichtigsten staats theoretischen Schriften der Aufklärung und begründet bis heute die Vorstellung von der Gewaltenteilung. 143Das politische Denken der Aufklärung Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d s C .C .B u hn r V er la gs | |
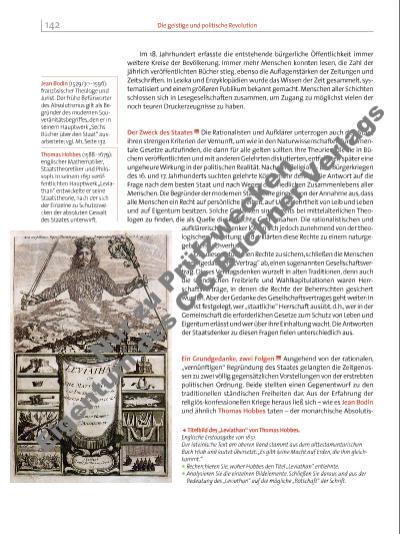 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |