| Volltext anzeigen | |
sprache war. Die Universitäten verstanden sich seit dem 16. Jahrhundert als Ausbildungsstätten, die für den Nachschub der Pfarrer und der rechtskundigen Beamten zu sorgen hatten. Die Studenten hatten demgemäß vor allem Texte aus der Theologie und Rechtswissenschaft auswendig zu lernen. Die Reformpläne der Aufklärer stellten die Elementarschule voran, die nun alle Heranwachsenden besuchen sollten. Preußen verfügte 1763 die allgemeine Schulpfl icht für Kinder zwischen fünf und 14 Jahren. Es dauerte freilich fast ein Jahrhundert, bis diese Verfügung wirklich durchgesetzt war. Auch die Lehrer sollten besser werden, wozu Joseph II. in Wien eine eigene „Normalschule“ zu ihrer Ausbildung einrichtete. Aber die Lehrer verdienten weiterhin so schlecht, dass sie von Nebenverdiensten leben mussten. So wurden die Reformziele bei den Elementarschulen verfehlt. Nicht ganz so negativ ist die Bilanz für die weiterführenden Schulen und Universitäten. Dort schwand der Einfl uss der Pfarrer und Ordensgeistlichen, die konfessionelle Erziehung aber bestand fort. Immerhin trat der Unterricht in Latein und Grie chisch zurück zuguns ten des Französischen, der Mathematik und der Naturkunde. Die Universitäten reformierten das Studium des Rechts, um die Absolventen besser auf die berufl iche Praxis vorzubereiten. Aber im Ganzen bewegte sich noch wenig. Der große Umbruch, der die Struktur der Gymnasien und Universitäten bis heute bestimmt, kam erst ab 1810. Bildung für Frauen? Den Mädchen und Frauen waren die weiterführenden Bildungswege, vor allem die Universitäten, verschlossen. Das Idealbild des Bildungsbürgertums erwartete, dass Frauen Lesen, Schreiben, Rechnen, Musizieren, Französisch sprechen und Zeichnen beherrschten. Erworben wurden diese Fertigkeiten an katholischen Ordensschulen, vielfach im Privatunterricht durch eigene Lehrer oder die Eltern. Dorothea Christiana Erxleben (1715 1762) und Dorothea Schlözer (1770 1825), die 1754 bzw. 1787 den Grad eines Doktors der Medizin bzw. der Philosophie erwarben, waren die ersten promovierten Frauen in Deutschland und als solche Ausnahmen. Der Vater Dorothea Schlözers, der Historiker August Ludwig Schlözer, sah die Ausbildung seiner Tochter geradezu als Experiment an, um die Befähigung von Frauen zu höherer Bildung zu beweisen. Das vorherrschende Leitbild der guten, untadeligen Mutter hingegen forderte ein anderes Verhalten. Die Frau sollte zwar im intellektuellen wie im seelischen Bereich die Gefährtin des Mannes sein, um so den Familienzusammenhalt zu fes tigen. Gelehrsamkeit aber war allein Sache des Mannes. Das Ideal der Zeit trennte somit noch zwischen der emotionsbesetzten Privatsphäre als der Welt der Frau und der Erwerbssphäre als der Welt des streitbaren Mannes. u „Der Unterricht der Kinder um Gottes willen, teils durch das Buch der Natur und Sitten, teils durch das Buch der Religion.“ Kupferstich aus Johann Bernhard Basedows „Elementarwerk“ von D. N. Chodowiecki, 1774. In dem von Basedow in Dessau gegründeten Philanthropinum („Pfl anzschule“) wollten die Lehrer durch möglichst große Anschaulichkeit und mithilfe spielerischer Elemente nicht nur Wissen vermitteln, sondern die Kinder auch charakterlich formen. Gemäß der Vorstellung der Aufklärer, dass alle Menschen dieselben Möglichkeiten haben, wurden Kinder unterschiedlichs ter Herkunft unterrichtet. 151 Der aufgeklärte Absolutismus Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge tu m d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 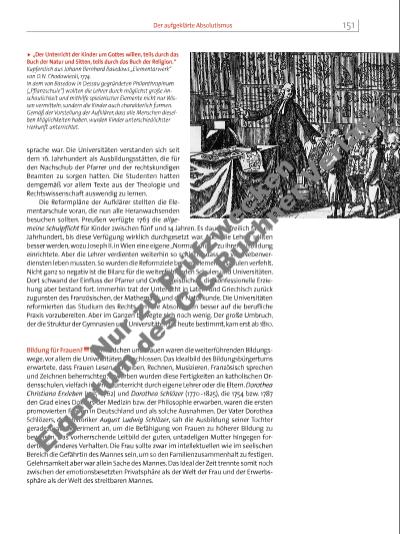 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |