| Volltext anzeigen | |
M1 „Vom Mythos zum Logos“ Der römische Dichter und Philosoph Lukrez, der die Naturphilosophie des Griechen Epikur im Rom des 1. Jahrhunderts v. Chr. bekannt macht, äußert sich in seinem Lehrgedicht „Über die Natur der Dinge“ zum Verhältnis von Göttern und Menschen in der griechischen Frühzeit: Als das Leben der Menschen darnieder schmählich auf Erden lag, zusammengeduckt unter lastender Furcht vor den Göttern, welche das Haupt aus des Himmels Gevierten prahlerisch streckten droben mit schauriger Fratze herab den Sterblichen [drohend], erst hat ein Grieche gewagt, die sterblichen Augen dagegen aufzuheben und aufzutreten als erster dagegen; den nicht das Raunen von Göttern noch Blitze bezwangen noch drohend donnernd der Himmel; nein, nur umso mehr noch den scharfen Mut seines Geistes reizte, dass aufzubrechen die dichten Riegel zum Tor der Natur als erster er glühend begehrte. Also siegte die Kraft des lebendigen Geistes, und weiter schritt er hinaus die fl ammumlohten Mauern des Weltballs, und das unendliche Weltall durchstreift’ er männlichen Sinnes; bringt von dorten zurück als Sieger, was zu entstehen, was aber nicht es vermag, begrenzte Macht einem jeden endlich wie sie gesetzt und der tief verhaftete Grenzstein. Drum liegt die Furcht vor den Göttern unter dem Fuß, und zur Rache wird sie zerstampft, uns hebt der Sieg empor bis zum Himmel. Jenes befürchte ich dabei, dass vielleicht du könntest vermeinen, ruchlosen Lehren zu folgen unsrer Vernunft und die Straße einzuschlagen der Sünde. Demgegenüber hat öfters jene Furcht vor den Göttern verursacht Frevles und Böses. Lukrez, Über die Natur der Dinge 1,62 68; zitiert nach: Karl Hönn, Lukrez. Die Bibliothek der Alten Welt, Zürich 1956, S. 73 Erläutern Sie, wodurch nach Lukrez die Menschen die „Furcht vor den Göttern“ verlieren. M2 Sokratisches Lehrgespräch Platon dokumentiert in seinen Dialogen philosophische Gespräche des Sokrates mit seinen Schülern: Sokrates: So muss sich deutlich machen, wer etwas erklärt. Wohlan, lass uns nun dieses gemeinschaftlich betrachten, ob es eine rechte Geburt ist oder ein Windei! Wahrnehmung, sagst du, sei Erkenntnis? Theaitetos: Ja. Sokrates: Und gar keine schlechte Erklärung scheinst du gegeben zu haben von der Erkenntnis, sondern welche auch Protagoras gibt, nur dass er diese nämliche auf eine etwas andere Weise ausgedrückt hat: Er sagt nämlich, der Mensch sei das Maß aller Dinge, der seienden, wie sie sind, der nichtseienden, wie sie nicht sind. Du hast dies doch gelesen! Theaitetos: Oftmals habe ich es gelesen. Sokrates: Nicht wahr, er meint dies so: Wie ein jedes Ding mir erscheint, ein solches ist es auch mir, und wie es dir erscheint, ein solches ist es wiederum dir. Ein Mensch aber bist du sowohl als ich. Theaitetos: So meint er es unstreitig. Sokrates: Wahrscheinlich doch wird ein so weiser Mann nicht Torheiten reden. Lass uns ihm also nachgehen! Wird nicht bisweilen, indem derselbe Wind weht, den einen von uns frieren, den andern nicht? Oder den einen wenig, den andern sehr stark? Theaitetos: Jawohl. Sokrates: Sollen wir nun in diesem Falle sagen, dass der Wind an und für sich kalt ist oder nicht? Oder sollen wir dem Protagoras glauben, dass er dem Frierenden ein kalter ist, dem Nichtfrierenden nicht? Theaitetos: So wird es wohl sein müssen. Sokrates: Und so erscheint er doch jedem von beiden? Theaitetos: Freilich. Sokrates: Dieses „erscheint“ ist aber eben das Wahrnehmen? Theaitetos: So ist es. Sokrates: Erscheinung also und Wahrnehmung ist dasselbe in Absicht auf das Warme und alles, was dem ähnlich ist? Denn wie ein jeder es wahrnimmt, so scheint es für ihn auch zu sein. Platon, Theaitetos 151 St. 1 E 152 St. 1 B; zitiert nach: www.opera-platonis.de/ Theaitetos.html [23. 09. 2013] 1. Erläutern Sie, was nach Sokrates Erkenntnis bedeutet. 2. Nennen Sie die Gründe für seine Ansicht. 3. Erklären Sie das methodische Prinzip, das die philosophischen Gespräche des Sokrates kennzeichnet. Recherchieren Sie ggf. im Internet unter dem Begriff „Maieutik“. 5 10 15 20 10 15 20 25 30 35 u Sokrates im Kreis seiner Schüler. Kupferstich von 1754 nach einem Gemälde von Bartolomeo Pinelli. 5 15Ein neues Denken entsteht Nu r z P rü fzw ck en Ei ge nt um d es C .C .B uc hn r V rla gs | |
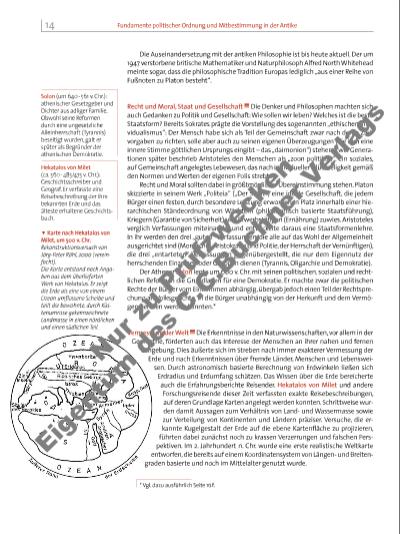 « | 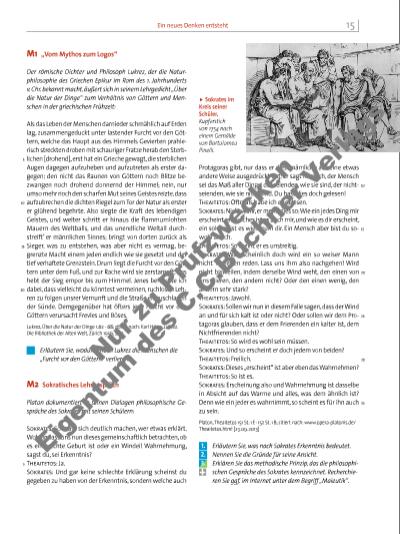 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |