| Volltext anzeigen | |
M1 Der Fürstenspruch von Würzburg 1121 Im Herbst 1121 fassen die Großen des Reiches auf einer Versammlung in Würzburg ohne den Kaiser den folgenden Beschluss: Das ist der Beschluss, auf den sich die Fürsten im Streit zwischen dem Herrn Kaiser und dem Reich verständigt haben: Der Herr Kaiser möge dem Apostolischen Stuhl gehorchen. Und über die böswillige Anklage, die die Kirche gegen ihn vorbringt, soll mit Rat und Beistand der Fürsten zwischen ihm und dem Herrn Papst ein Vergleich geschlossen werden, und der Friede soll so sicher und unverbrüchlich sein, dass der Herr Kaiser das erhalte, was ihm und dem Reich gehört, und die Kirche und jede andere das Seinige ruhig und friedlich besitze. [...] Wenn aber der Herr Kaiser diesen Ratschlag außer Acht lassen sollte, dann werden die Fürsten dennoch den Treueid so einhalten, wie sie ihn einander geschworen haben. Zitiert nach: Johannes Laudage und Matthias Schrör (Hrsg.), Der Investiturstreit. Quellen und Materialien, Köln 2006, S. 225 1. Erläutern Sie die Forderungen der Fürsten an den Kaiser. Stellen Sie vor dem historischen Hintergrund Überlegungen zu ihren Motiven an. 2. Beurteilen Sie die Bedeutung des Fürstenspruchs von 1121. 3. Vergleichen Sie den von den Fürsten formulierten Lösungsvorschlag mit der im Jahre 1122 im Wormser Konkordat getroffenen Vereinbarung (siehe dazu Seite 49). M2 Reichsspruch über das Recht der Landstände (1231) Heinrich (VII.) wird 1220 von den deutschen Fürsten zum König gewählt und von seinem Vater, Kaiser Friedrich II., als (Mit-) Regent für den deutschen Reichsteil eingesetzt. In dieser Position steht Heinrich zwischen den Fürsten, denen gegenüber er die Interessen des Königtums zu wahren versucht, und dem auf Ausgleich mit den Fürsten bedachten Kaiser. Im Jahr 1231 erlässt er folgenden Reichsspruch über das Recht der Landstände: Heinrich, von Gottes Gnaden Römischer König und allzeit Mehrer des Reiches, entbietet allen Getreuen des Reiches seine Huld und alles Gute. Wir wünschen, es möge allen bekannt sein: Als Wir zu Worms einen feierlichen Hoftag durchführten, wurde der Antrag gestellt, in Unserer Gegenwart möge entschieden werden: Darf einer der Landesherren irgendwelche Erlasse oder neue Gesetze machen, ohne dass die Vornehmen und Großen des Landes irgendwie hinzugezogen worden wären. In dieser Sache wurde unter der erbetenen Zustimmung der Fürsten Folgendes entschieden: Weder Fürsten noch andere sonst dürfen Erlasse oder neue Gesetze machen, es sei denn man erlangt zuvor die Zustimmung der Vornehmen und Großen des Landes. Zur Rechtskraft dieses Spruches also, die für immer und ewig gelten soll, haben Wir dieses Schriftstück abfassen und mit Unserem Siegel versehen lassen. Die Folgenden sind Zeugen: Siegfried Erwählter1 von Mainz und die Erzbischöfe von Magdeburg und von Trier; die Bischöfe von Würzburg, von Regensburg – zugleich Kanzler des kaiserlichen Hofes –, von Worms und von Chur und recht viele andere. Zitiert nach: Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschaftsund Sozialgeschichte bis 1250, ausgewählt und übersetzt von Lorenz Weinrich, Darmstadt 1977, S. 422 f., Nr. 108 1. Analysieren Sie, was der Reichsspruch bewirken soll. Welche Positionen des Königs und der Landesherren werden aus dem Reichsspruch deutlich? 2. Erläutern Sie, wem die Regelung von 1231 entgegenkam. 3. Begründen Sie, inwiefern der Reichsspruch von 1231 eine Neuerung darstellte. Gestalten Sie ein Plakat, auf dem diese Regelung aus Sicht des Königs öffentlichkeitswirksam dargestellt wird. M3 Ritual und Verfassungswirklichkeit Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger untersucht die Verfassungswirklichkeit im Alten Reich: Das Reich des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit gehorchte der Logik einer Präsenzkultur, d. h. es wurde dadurch zu einem Ganzen integriert, dass sich die Akteure von Zeit zu Zeit persönlich an demselben Ort versammelten. Seine Ordnung wurde [...] immer wieder aufs Neue erzeugt, indem sie pars pro toto2 öffentlich aufgeführt wurde. Das geschah in symbolisch-rituellen, feierlichen und förmlichen, mit dem zeitgenössischen Wort: solennen Akten, die durch vielerlei symbolische Markierungen aus dem alltäglichen Handlungsfl uss herausgehoben waren: vor allem Krönungen, Lehnsinvestituren, Reichstagseröffnungen und -abschiede. Die äußeren Formen waren wesentlich. Denn die Ordnung, die diese Rituale erzeugten, war konkret, nicht abstrakt. Man musste sie sehen können: [...] Kaiser, Römischer König und Kurfürst, Reichsfürst, Reichsgraf, Reichsstadt und so fort 1 gewählter, aber noch nicht geweihter Erzbischof von Mainz 2 pars pro toto (lat.: „ein Teil für das Ganze“): rhetorisches Stilmittel, mit dem ein Ganzes durch einen Teil bezeichnet wird (z. B. „ein kluger Kopf“ statt „ein kluger Mensch“) 5 10 5 10 15 20 5 10 15 61Wurzeln des modernen Föderalismus im Heiligen Römischen Reich N r z u Pr üf zw ck n Ei g tu m d es C .C .B uc h er V er la gs | |
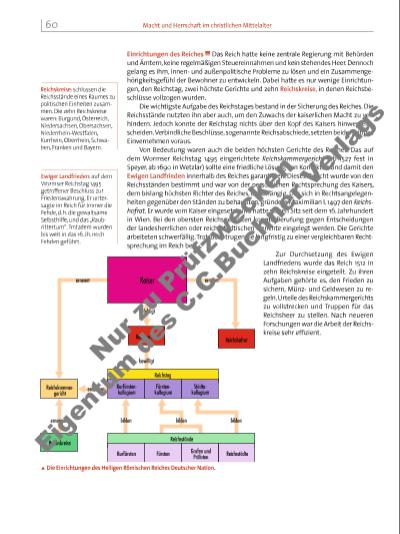 « | 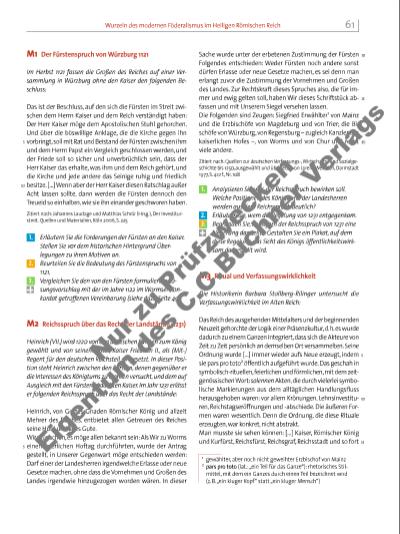 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |