| Volltext anzeigen | |
öffentlichen gegenseitigen Treueid bekräftigt: Der Lehnsherr verpfl ichtete sich zu „Schutz und Schirm“, der Lehnsmann zu „Rat und Hilfe“. Die Kronvasallen, die direkt vom König belehnt wurden, vergaben einen Teil ihrer Lehen an Dienstleute (Ministerialen) zur Bewirtschaftung weiter. So entstand ein System von Vasallen und Untervasallen, das durch ein Gefl echt persönlicher Treuebeziehungen zusammengehalten wurde. Aus dem Ertrag der Lehen sollte der Vasall seine Dienstpfl ichten erfüllen und einen angemessenen Lebensstil bestreiten können. Das Vasallitätsverhältnis endete mit dem Tod von einem der beiden Partner oder bei Treuebruch; dann konnte das Lehen vom Lehnsgeber wieder eingezogen werden („Heimfall“). Im Lauf der Jahrhunderte setzte sich die Erblichkeit der Lehen durch: Zulasten des hohen Adels konnten die Ministerialen erreichen, dass ihr Lehen nur dann an den Lehnsherrn zurückfi el, wenn sie ohne Erben starben. So bildete sich aus den ursprünglich vom Hochadel abhängigen Dienstleuten der eigene Stand des niederen Adels, der als bewaffneter Ritterstand ein eigenes Standesbewusstsein pfl egte. Durch die veränderte Kriegsführung mit Feuerwaffen und Söldnerheeren verloren die Ritter jedoch zunehmend ihre Funktion im Kampf. Viele Familien verarmten und die Ritter gerieten zum großen Teil in die Abhängigkeit mächtiger Territorialherren. Als Ausgleich für den Verlust der Selbstständigkeit boten die Landesherren den Rittern attraktive Aufgaben im Militär, in der Verwaltung und den vielen Hofämtern an den Residenzen. Diese entwickelten sich zwischen dem 16. und ausgehenden 18. Jahrhundert zu politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentren. Der höfi sche Lebensstil wurde im absolutistischen Zeitalter zur Leitkultur des Adels und des reichen Bürgertums. Mit seinen prunkvollen Festen, Banketten und Jagdgesellschaften, dem Hofzeremoniell und einer festen Rangordnung galt der Hof als Gradmesser fürstlicher Größe und verlieh auch demjenigen Glanz und Ansehen, der dort eine Stellung einnahm. Bürgerliche, die sich durch besondere Dienste auszeichneten, wurden von Kaisern und Fürsten in den Adelsstand erhoben (Nobilitierung). Die Landesherren konnten sich so eine loyale Elite heranziehen und diese dem alten Adel entgegensetzen. Die Grundherrschaft als Fundament der Ständegesellschaft Die Grundherren übertrugen Teile ihres Landes Bauern ohne eigenen Grundbesitz, den sogenannten Hörigen oder Grundholden, zur Nutzung und stellten ihnen einen Hof mit den notwendigen Geräten zur Verfügung (u M2). Dafür beanspruchten sie nicht nur Abgaben aus den Erträgen. Vielmehr mussten die Bauern für den Herrenhof (Fronhof, althochdeutsch frô: „Herr“) unterschiedliche Frondienste leisten oder Zugvieh und Geschirr bereitstellen (Handund Spanndienste). Darüber hinaus übte der Grundherr die Aufsicht über die Grundholden aus und besaß das Recht, bei Strafe zu gebieten und zu verbieten. Zudem war er Gerichtsherr über die von ihm abhängige bäuerliche Bevölkerung. Im Gegenzug hatte er Schutz und Sicherheit zu gewähren. Zu den Abgaben und Diensten für die Überlassung des Landes konnten Bußund Gerichtsgelder hinzukommen, außerdem Abgaben an die Kirche. Die bäuerliche Bevölkerung musste also viele Ansprüche erfüllen, die sich auf mehrere „Herren“ verteilen konnten, wenn die Grundherrschaften zersplittert waren. Alle diese Forderungen waren nicht immer schriftlich festgehalten, sondern mündlich überliefert und gewohnheitsrechtlich festgelegt. Die Grundherrschaft prägte die Gesellschaft auf dem Land vom frühen Mittelalter bis ins späte 18. Jahrhundert. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung der vorindustriellen Zeit gehörten ihr an. Der Begriff stammt allerdings nicht aus der Zeit selbst; erst die moderne Geschichtswissenschaft bezeichnet damit die Verfügungsgewalt über Grund und Boden mit den darauf lebenden Menschen – die „Herrschaft über Land und Leute“. i Spiel auf Leben und Tod. Buchmalerei aus der Manessischen Liederhandschrift, Anfang 14. Jh. Das Turnier war Unterhaltung und sportliches Training für den Kampf. Die Tjost ist ein turniermäßiger Zweikampf: Zwei Ritter reiten gegeneinander an und versuchen, den Gegner mit der Lanze aus dem Sattel zu stoßen. 65Die mittelalterliche Ständegesellschaft Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 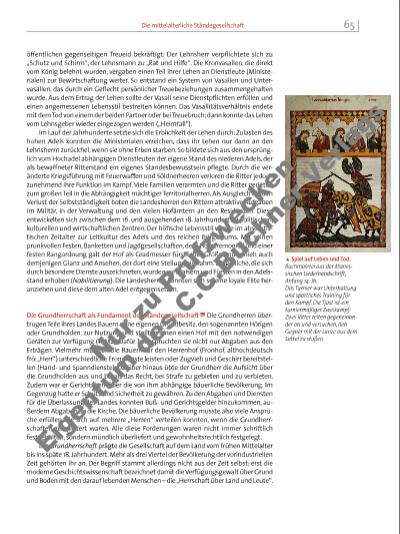 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |